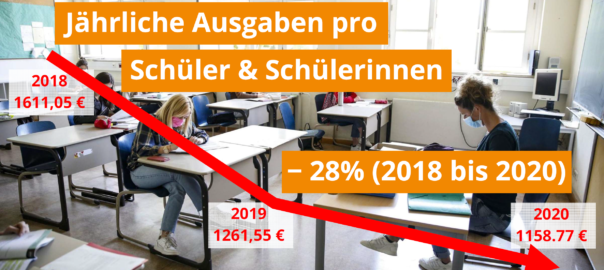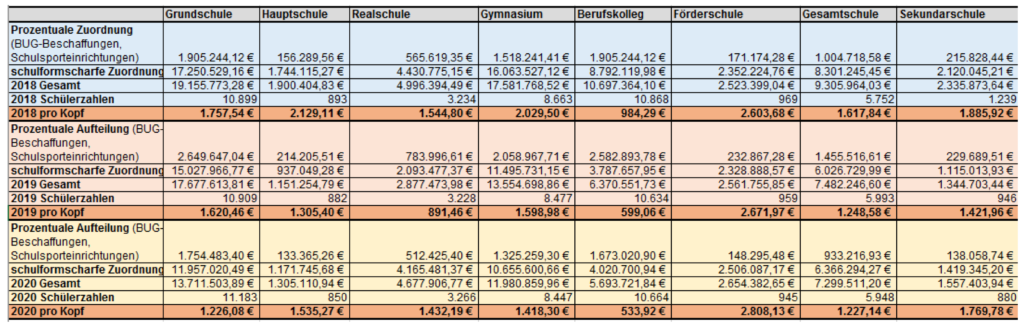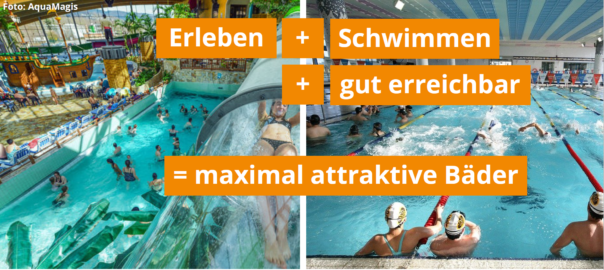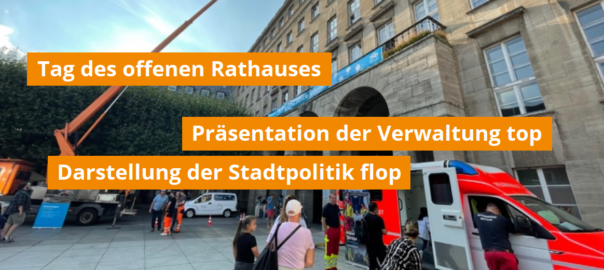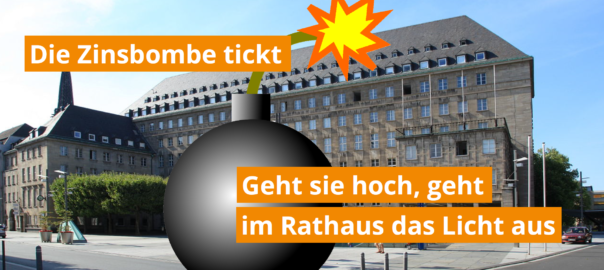Die Stadtfläche muss besser genutzt werden: Mehr Grün, weniger Asphalt, mehr Wohnraum

Jeder Quadratmeter in der Stadt existiert nur einmal und jeden Quadratmeter sollte man möglichst optimal nutzen. Von der optimalen Nutzung der Stadtfläche hängt letztlich die Lebensqualität und Attraktivität einer Stadt ab. Leider fehlt Bochum bisher ein Konzept wie jeder Quadratmeter Stadtfläche möglichst optimal genutzt werden kann
Ein Quadratmeter Stadtfläche kann Teil einer grünen Oase sein, Teil eines Parkplatzes, einer Straße oder auf ihm kann ein Gewerbebetrieb wie ein Wohngebäude stehen. Ein Wohnhaus kann mehrgeschossig sein und über einen Dachgarten sowie eine Solaranlage verfügen oder es kann eingeschossig sein mit einem Flachdach, das nur mit Dachpappe gedeckt ist. So verschieden wie die Nutzung ist, so unterschiedlich ist auch der Wert, den die Nutzung für die Stadt hat.
Die Nutzungsoptimierung von Stadtflächen
Drei Nutzungsperspektiven können unterschieden werden, der individuelle Nutzen einzelner Einwohner*innen, der Nutzen für die Stadt bzw. das Ruhrgebiet und der Nutzen für das gesamte Land. Ein Stellplatz etwa hat nur Nutzen für jemanden, der dort sein Auto abstellt, ein Stadtplatzlatz dagegen einen Nutzen für alle, die in dem Viertel leben und den Platz nutzen. Eine Autobahn, eine Bahnlinie oder ein weltweit agierender Industriebetrieb kann auch einen überregionalen Nutzen für das ganze Land haben. Entsprechend ist der Nutzen für jeden Quadratmeters Stadtfläche unterschiedlich zu bewerten.
Ziel der Stadt sollte es sein, Maßnahmen zu entwickeln, die sicherstellen, dass jeder Quadratmeter möglichst optimal genutzt wird. Das bedeutet zum Beispiel Wohngebäude sollten in Abstimmung mit der Umgebung mit möglichst vielen Etagen gebaut werden, um auf einem Quadratmeter möglichst viel Wohnraum zu schaffen. Es sollte die Verpflichtung zur Begrünung von Dach und Fassaden bestehen. Um den Nutzwert der Fläche zu maximieren sollte zudem eine energetische Nutzung des Dachs bzw. des Grundstücks (solar oder mit Erdwärme) vorgesehen werden.
Mobilität ist ein Grundbedürfnis in einer Stadt, trotzdem sollten die Verkehrsflächen auf das notwendigste minimiert werden. Verkehrsmittel, die wenig Fläche für den Transport vieler Menschen beanspruchen, sollten gegenüber denen bevorzugt werden, die viel Platz für den Transport weniger Menschen benötigen. Ein weiteres städtisches Ziel sollte sein, die negativen Effekte von Verkehr wie Lärm, Luftverschmutzung, Flächenversiegelungen, Wertminderungen zu minimieren. Statt Stadtflächen als Stellplätze für Autos. zu nutzen, kann man sie besser als Grün-, Platzflächen, für Verkehrswege oder für Wohngebäude nutzen. Der Nutzen eines Parkplatzes ist nur für denjenigen, der ihn nutzt hoch für die Stadt aber gering, der Wert für alternative Nutzungen deutlich höher, insbesondere da die Fläche von erheblich mehr Einwohner*innen genutzt werden kann oder ein positiver Effekt für Klima- und Umwelt erreicht wird. Irgendwo abgestellt werden müssen die Autos aber gleichwohl. Das muss unter bestmöglicher Ausnutzung der Fläche geschehen also am besten in mehrstöckigen Parkhäusern oder unter Wohngebäuden.
Für die Attraktivität und Wohnqualität der Städte ist Grün wichtig sowie Straßen und Plätze, die zum Leben im öffentlichen Raum einladen. Der Nutzen eines asphaltierten Quadratmeters ist ggü. einer Fläche, der als Beet genutzt wird, auf dem ein Baum, ein Spielgerüst oder eine Bank steht gering. Trotzdem müssen Flächen asphaltiert werden, da Verkehrswege in jeder Stadt unverzichtbar sind, um sicher und schnell von A nach B zu kommen. Die Zahl der Verkehrswege sollte aber wegen des hohen Nutzens einer alternativen Nutzung auf das unbedingt notwendige Maß begrenzt werden.
Frei- und Naturflächen sind für das Klima wie die Attraktivität und das Lebensgefühl in einer Stadt von großer Bedeutung. Entsprechend groß ist ihr Nutzen und der Wert hoch, so dass sie, wenn irgend möglich, unbebaut erhalten bleiben sollten.
Im Bereich des Gewerbes können wenige Arbeitsplätze auf einer großen Fläche entstehen (z.B. DHL auf Mark 51°7) oder viele Arbeitsplätze in einem mehrstöckigen Bürogebäude. Der Nutzen pro Quadratmeter städtischer Fläche kann also auch hier recht unterschiedlich sein. Auch können z.B. Industriebetriebe negative Folgen, wie Lärm und Luftverschmutzung mit sich bringen, die den Nutzwert schmälern, aber auch einen positiven gesamtgesellschaftlichen Nutzen für das ganze Land mit sich bringen, der den Nutzwert pro Quadratmeter erhöht. Beide Effekte sind bei einer Nutzenbewertung zu berücksichtigen.
Einbeziehung der negativen Folgen von Nutzungen
Bewertet die Stadt den Nutzen eines Quadratmeters muss sie also den gesamtgesellschaftlichen Nutzen der Fläche betrachten und die negativen Folgen der Nutzung für die Stadt (Lärm, Luftverschmutzung usw.).
Hauptsächliche Nutzung einer Fläche und zusätzliche Nutzungen
Grundsätzlich kann jedem Quadratmeter Fläche eine Hauptnutzung zugeordnet werden, Natur- und Freifläche, Wohnen, Gewerbe, Verkehr, Freizeit. Die Intensität der Nutzung kann dabei je nach Intensität der Nutzung variieren. Ob eine Freifläche als Acker oder als Wald genutzt wird, führt zu einem unterschiedlichen Nutzwert, insbesondere wenn man den Nutzen hinsichtlich des Klimaschutzes bewertet. Steht auf einem Quadratmeter Fläche ein mehrstöckiges Wohn- oder Parkhaus, ist die Nutzung ebenfalls intensiver und der Nutzwert höher, als bei einstöckigen Nutzungen.
Zu der Hauptnutzung kommen Zusatznutzungen hinzu. Zur Nutzung als Wohnfläche kann ein Quadratmeter zusätzlich als Parkfläche, Gartenfläche und Fläche zur Energieerzeugung, ja sogar landwirtschaftlich genutzt werden, wenn das Gebäude über eine Tiefgarage, einen Dachgarten, eine Solaranlage und ggf. sogar eine landwirtschaftliche Dachnutzung mit einem Gewächshaus verfügt. In der Stadt sollte also das Ziel verfolgt werden, dass jeder Quadratmeter Fläche nicht nur mit seiner Hauptnutzung einen möglichst hohen Nutzwert erzielt, sondern darüber hinaus noch möglichst vielen zusätzliche Nutzungen aufweist.
Exkurs: Ökonomisch-mathematische Modell zu flächenoptimierter Stadtplanung
Die Stadt Bochum ist 145.400.000 Quadratmeter groß. Jedem Quadratmeter könnte ein Nutzwert zugeordnet werden, der angibt wie gut die entsprechende Fläche genutzt wird. Die Summe aller Nutzungswerte gäbe dann wieder, wie gut die gesamten Stadtfläche genutzt wird. Entsprechend sollte diese Summe, der Flächennutzwert der gesamten Stadt, maximiert werden.
Bei der Maximierung dieses Zielwertes sind jedoch diverse Restriktionen zu berücksichtigen. Unter anderem sollte eine vorgegebene Verkehrsfläche sowohl an Verkehrswegen wie Stellflächen vorhanden sein. Weiterhin sollte festgelegt werden, welcher Teil an städtischer Fläche auf jeden Fall von Bebauungen freigehalten werden soll. Ebenso wäre vorzugeben, welche Fläche für Wohnraum in jedem Fall zur Verfügung stehen muss. In diesem Sinne ist die Berücksichtigung weiterer Restriktionen sinnvoll.
Mit Zielfunktion und Restriktionen ließe sich ein lineares Optimierungsmodell aufstellen, mit dem mathematisch die Flächennutzung der gesamten Stadt optimiert werden könnte. Insbesondere ließe sich mit dem Modell analysieren, wie sich in der Stadt eine Veränderung der Flächennutzung auf den Gesamtflächennutzwert auswirken würde und welche Nutzungsänderungen wo in der Stadt besonders sinnvoll wären.
Ein solches komplexes mathematisches Modell kann also ein sinnvolles Instrument zu einer strategischen Maximierung des Gesamtflächennutzwertes der Stadt sein.
Von der autogerechten Stadt zur Stadtplanung nach menschlichem Maßstab
Die Nutzung der Stadtflächen entsprechend den Bedürfnissen der Stadtbewohner*innen zu maximieren, ist erst seit wenigen Jahrzehnten Ziel der Stadtplanung. Der vielleicht weltweit prägendste Stadtplaner unserer Zeit, der Däne Jan Gehl. hat dafür den Begriff Human Scale geprägt (Menschlicher Maßstab). Im Mittelpunkt der Stadtplanung steht bei Gehl der Mensch als Wesen, das bestimmte Bedürfnisse im Lebensraum befriedigen will. Das Ziel der Stadtplanung ist es, die Lebensqualität der Menschen als Bewohner*innen der Städte zu erhöhen (Jan Gehl: “In The Last 50 Years, Architects Have Forgotten What a Good Human Scale Is”). Zuvor war Stadtplanung allein auf das Transportmittel Auto fixiert. Nicht die Bedürfnisse der Menschen standen im Mittelpunkt der Stadtplanung, stattdessen wurde als Ziel verfolgt die Stadt möglichst autogerecht zu gestalten.
Dem Paradigmenwechsel, nicht mehr das Auto als Maßstab der Stadtplanung zu verfolgen, sondern die Bedürfnisse der Menschen in den Mittelpunkt der Stadtplanung zu stellen, folgt logisch das Ziel den Nutzwert der Stadtfläche im Sinne der Stadtbewohner*innen ständig weiter zu maximieren. Dies geschieht jedoch bisher wenig systematisch, sondern vielmehr relativ zufällig von Projekt zu Projekt. In der Stadt werden Stadtplanungsdefizite erkannt,. Orte, an denen man die Stadt mehr den Bedürfnissen der Menschen anpassen kann werden entsprechend umgestaltet, in Bochum zum Beispiel der Husemannplatz.
Systematische Nutzenmaximierung im Rahmen der Stadtplanung
Eine systematische Maximierung der Nutzwerte von Stadtflächen erfolgt bislang nicht. So wird bei Wohngebäuden häufig keine Maximierung der Wohnfläche eingefordert und sind auch mögliche Zusatznutzen nicht Gegenstand der Planungen. Nur selten werden unterschiedliche Planungsalternativen für Bebauungs- oder Stadtsanierungsgebiete entwickelt. Eine Ermittlung von Flächennutzwerten findet bisher gar nicht statt, entsprechend können sie auch nicht in die Entscheidungen der Politik, welche Planungen realisiert werden sollen, einfließen. In der Regel wird der erstbeste Vorschlag realisiert. Die Politik entscheidet aus dem Bauch heraus, da es an konkreten und systematisch ermittelten Entscheidungskriterien wie Nutzwerten fehlt.
Dabei wäre es wichtig zu wissen, welchen Nutzwert hat eine Fläche vor einer Umgestaltung oder Neubebauung, welcher soll durch die Stadtplanungsmaßnahme erreicht werden und mit welcher Planungsvariante kann das Zeil am besten erreicht werden.
Negativbeispiel: Dietrich-Benking-Straße Ost
Es reicht nicht wie etwa bei dem Bauvorhaben Dietrich-Benking-Straße Ost, zu beschließen eine Fläche zu bebauen und dann den erstbesten Vorschlag mit einer ideenlosen Bebauung mit überwiegend Reihenhäusern und übermäßig vielen Verkehrsflächen und entsprechend geringem Flächennutzwert durchzuwinken (Städtebauliches Konzept Dietrich-Benking-Straße Ost).

Wenn man ein Feld wie an der Dietrich-Benking-Straße bebauen will, dann hätte unter der Vorgabe den Nutzwert pro Quadratmeter zu maximieren erheblich mehr Wohnraum geschaffen werden müssen und es hätte wesentlich weniger Verkehrsfläche entstehen dürfen und es hätten viel mehr Grünflächen auf dem Gelände verbleiben müssen. Diese Ziele hätten mit dem Bau einer Quartiersgarage an der Dietrich-Benking-Straße, einer Verpflichtung zu Dach- und Fassadenbegrünung sowie einer mehrstöckigen Bebauung erreicht werden können. Auch hätte die Erzeugung von Strom und Wärme mittels Solar- und Erdwärmeanlage Gegenstand des Planungsprojekts sein müssen. Mehr als ein Drittel der Fläche zu asphaltieren oder als Stellplatzflächen vorzusehen, ist hingegen ideen- wie anspruchslos und widerspricht allen Grundsätzen moderner Stadtplanung. Auch der Versuch der Fraktion “Die PARTEI und die STADTGESTALTER”, die Planungen noch zu korrigieren scheiterte, der Antrag (Vorlage 20213996) die Verkehrsflächen deutlich zu reduzieren und die Bauherren zur Einhaltung eines höheren Energiestandards zu verpflichten, wurde vom Ausschuss des Stadtrates abgelehnt.
Das Vorhaben an der Dietrich-Benking-Straße zeigt anschaulich, weder bei der Verwaltung noch im Stadtrat wird bisher systematisch das Ziel verfolgt, bei jeder Neu- oder Umplanung die städtische Fläche möglichst optimal zu nutzen und damit einen möglichst hohen Flächennutzwert zu erreichen. Es ist höchste Zeit sich mit dieser Thematik zu befassen.