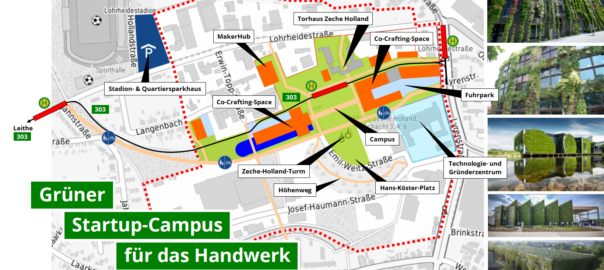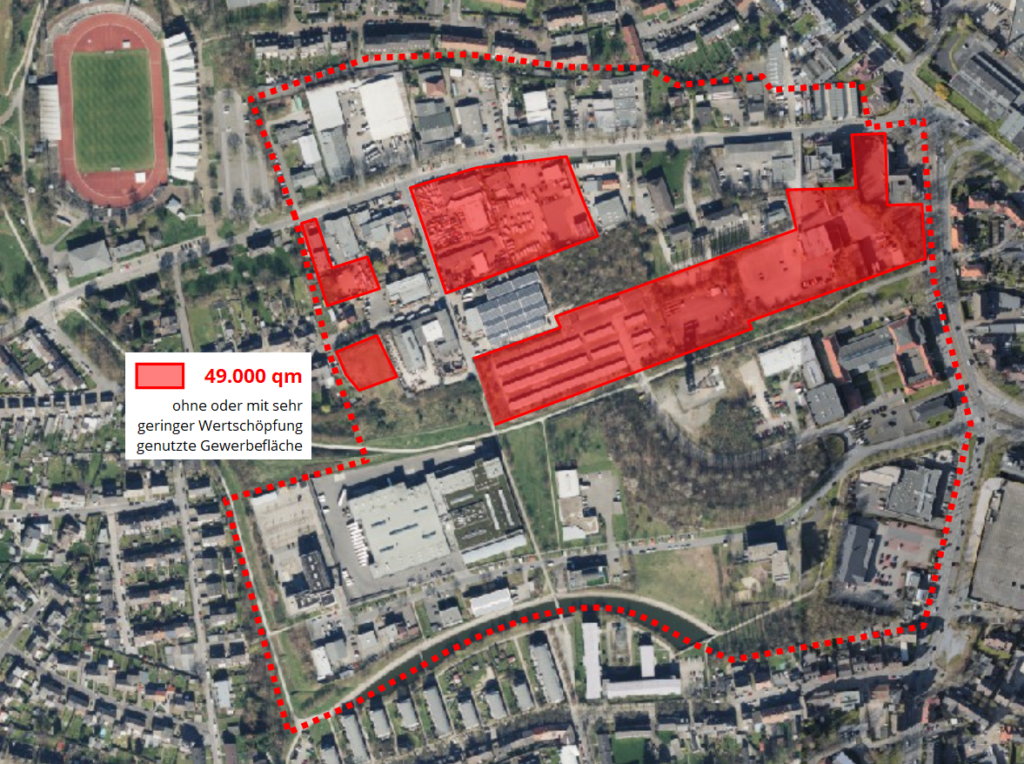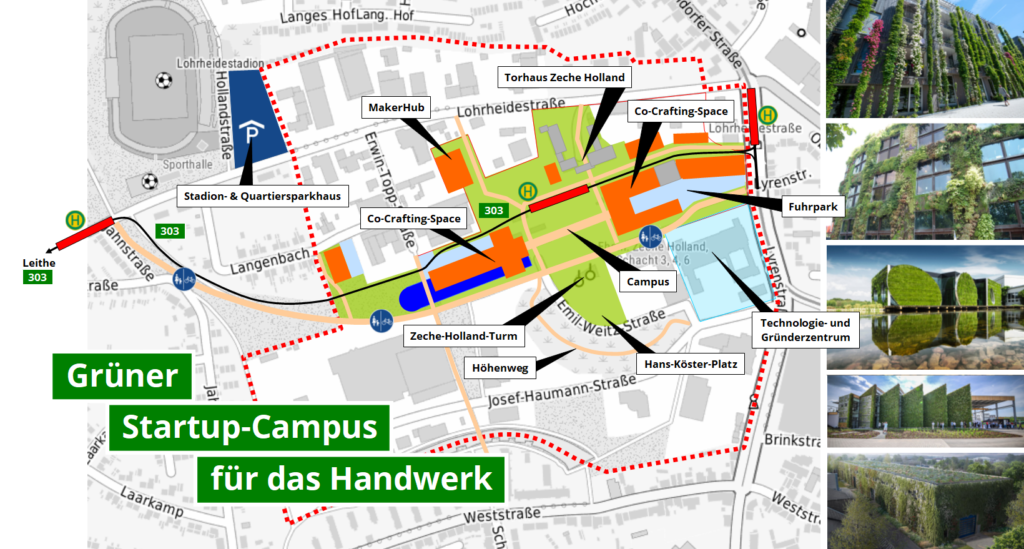Zeche-Holland Gelände verkommt immer mehr

2021 wurde der Platz rund um das Fördergerüst der ehemaligen Zeche Holland eingeweiht. Kaum zwei Jahre später sind die meisten Missstände immer noch nicht beseitigt. Darüber hinaus verschandeln Müll, Schmierereien, Unkrautwildwuchs und hässliche Provisorien den Platz und seine Umgebung. Die Bilder im Beitrag sprechen Bände.
Kommt man auf den Zeche-Holland-Platz und weiß wie engagiert einige Bürger und Bürgerinnen sich in einer Initiative dafür eingesetzt haben, dass hier ein freundlicher und vorzeigbarer Ort geschaffen wird, an dem sich Menschen aus Wattenscheid und Umgebung treffen können, ist man geschockt. Der Zustand des Platzes ist traurig.
Seitdem 2022 bereits über die Mängel auf dem Platz berichtet wurde (Trauerspiel am Zeche-Holland-Turm) hat sich der Zustand des Platzes nicht etwa verbessert, sondern noch weiter verschlechtert.
Gastro-Container – Immer noch hat es die Verwaltung nicht geschafft, den Gastro-Container vernünftig aufzustellen zu lassen. Statt neben, steht der Container immer noch zu fast einem Drittel auf der gepflasterten Fläche, die eigentlich erst vor dem Container beginnen sollte. Der Container wurde zudem abenteuerlich mit allem aufgebockt, was sich in der Gegend um den Platz so fand. Eigentlich sollte der Container auf einem ordentlichen Fundament stehen. Doch das fehlt weiterhin.

Zudem hat es die Stadt auch in zwei Jahren nicht hinbekommen einen Wasseranschluss zu legen. Das Wasser für die Gastronomie kommt aus einem Hydranten der Nebenstraße und wird dann mit einer fliegenden Leitung über die den Platz umgebende Haldenaufschüttung bis zum Container geleitet. Die Konstruktion, die den Hydranten vor fremden Zugriffen schützen soll, versperrt den Gehweg. Statt endlich Abhilfe zu schaffen und die beim Bau des Platzes vergessene Wasserleitung zum Gastro-Container zu legen, ignoriert die Verwaltung das Problem und tut so, als gäbe es das nicht.

Gehweg – Der Bürgersteig, der am Rand des Platzes entlang läuft, wurde immer noch nicht fertiggestellt. Es fehlt der Oberflächenbelag. Die Menschen müssen über den groben Schotter laufen. Die Stadt ist offenbar nicht in der Lage den Gehweg endlich zu Ende zu bauen.

Platzbelag, Treppenanlage und Bänke – Währenddessen wird der Dolmitboden auf dem Platz bei Regen weiterhin in die Senke vor dem Turm gespült, Wo der Dolomitoberboden wegeschwemmt wurde, sind gefährliche Stolperkanten entstanden. An anderen Stellen versinkt man im matschigen Boden. Der Boden ist so weich, dass Hunde dort Löcher graben. Der Einbau einer zusätzlichen Überlaufrinne, konnte gegen das Wegspülen des Dolomits nur bedingt Abhilfe schaffen. Das Wasser, das sich sich bei jedem Regen wasserfallartig über die Treppenanlage ergießt, hat auch dort bereits Spuren hinterlassen. Die Treppensteine sehen versifft aus.

Die Sitzhölzer der Steinbänke sind schon binnen zwei Jahren spröde geworden, den Kalk drückt es aus den Fugen der Ziegelsteine. Die Mülleimer zieren die in Bochum und Wattenscheid üblichen Mülltütenkragen. Der Müllsack wird zu groß gewählt, in den Müllbehälter eingelassen und nach außen noch 20 cm übergestülpt. Sieht hässlich aus und zeigt, dass auf ein gutes Platzbild wenig Wert gelegt wird.

Bäume und Pflanzen – Zu befürchten ist, dass die Bäume unterhalb von Gastro-Container und Boule-Bahn geschädigt sind. Einige treiben bisher kaum aus, Zu sehen sind nur wenige Knospen, während die Bäume am Platzrand und auf dem oberen Platzteil schon blühen und kleine Blätter haben.

Die für den Haldenraum typische Bepflanzung auf den aufgeschütteten Hügeln, die dem Platz einen besonderen Charakter geben sollte, kann dagegen die von den Freiraumplaner*innen vorgesehene Wuchshöhe von 60 cm nie erreichen. Die technischen Betriebe mähen die entsprechenden Flächen regelmäßig ab, als handle es sich um Wiesen. Dafür wächst auf der Dolomitfläche unkontrolliert, teilweise schon flächendeckend das Unkraut.

Schmierereien, Müll und Rost– Am Zechengerüst selbst zeigen sich erste Roststellen. Noch ließen sich die Schäden leicht beseitigen, frisst sich der Rost allerdings tiefer in das Eisen, ist eine erneute und teure Sanierung der gesamten Konstruktion erforderlich. Die in drei Zentimeter Höhe über den Betonfundamenten der Stützpfeiler des Fördergerüsts gezogenen Blitzableiter stellen immer noch erstklassige Stolperfallen da.

Die Fundamente des Fördergerüsts wurden mittlerweile mit Schmierereien verunstaltet, rund herum liegen Scherben und Müll. Besonders vermüllt ist der Bereich hinter den Parkplätzen am Turm und die bereits halb verfallene Anlage an der Einfahrt zum Zeche-Holland Gelände. Hier scheint die Stadt jede Pflege aufgegeben zu haben.

Auf dem Nachbargrundstück, das die Stadt an die dort ansässige Druckerei verkauft hat, wurde ein abenteuerlicher Steg aus Paletten aufgebaut, um nach Regenfällen das Wasser aus dem sich bildenden See abzupumpen. Solche Konstruktionen sind sonst eigentlich vorwiegend in Favelas vorzufinden.

Technischer Betrieb und Verwaltung schauen weg
Die Beschäftigten des technischen Betriebs treffen sich an jedem Arbeitstag mit ihren orangen Dienstfahrzeugen auf dem Parkplatz hinter dem Holland-Gelände zu ausgiebigen Pausen, fahren also jeden Tag mehrfach an dem neuen Platz vorbei. Für die fortschreitende Verwahrlosung des Platzes und der Umgebung interessieren sie sich anscheinend jedoch nicht, wie offenbar auch sonst niemand in der Verwaltung. Hat man sich bereits an solche Zustände gewöhnt und hält sie in Wattenscheid für normal? „Woanders ist auch scheiße,“ der Spruch mag auch hier stimmen – denn an manchen Orten in Wattenscheid Mitte sieht es teilweise noch schlimmer aus – doch eine Rechtfertigung Dinge verkommen zu lassen und Mängel nicht zu beseitigen, ist der Spruch dennoch nicht.
Was ist das Ziel der Verwaltung? Den Platz weiter verkommen zu lassen, dann für Jahre einen Bauzaun drum zu stellen und auf neue Fördermittel zu warten, um Turm und Platz ein weiteres Mal zu sanieren? Der Platz wurde erst im Juni 2021 eröffnet. Wie er nach nur zwei Jahren aussieht und dass die Verwaltung es immer noch nicht geschafft hat, die diversen Baumängel und Provisorien zu beseitigen, ist ein Armutszeugnis.
Leider zeigt auch dieses Beispiel wie wenig zielgerichtet in manchen Bereichen der Stadt gearbeitet wird und wie gering offenbar der Ehrgeiz ist, das Stadtbild in einem vorzeigbaren Zustand zu erhalten.
Nach Fertigstellung treten bei fast jedem Bauprojekt Mängel auf. Bei gutem Projektmanagement werden diese dann schnell beseitigt. Nacharbeiten gehören dazu, wenn Dinge neu gebaut werden und sind entschuldbar. Wenn eklatante Mängel aber auch zwei Jahre später immer noch bestehen und sich offenbar um eine Abstellung nicht gekümmert wird, dann müssen sich die Verantwortlichen Unfähigkeit vorwerfen lassen. Es sieht leider nicht so aus, als sei die Stadt in der Lage, die bekannten Missstände endlich abzustellen und den Platz auf Dauer in einem vorzeigbaren Zustand zu erhalten.
Bürgerinitiative verprellt
Zudem hat die Stadt diejenigen verprellt, die sich für die Schaffung des Platzes eingesetzt und angeboten hatten, den Platz mit Veranstaltungen. Turmevents und Besichtigungstouren zu bespielen. Turmbesichtigungen dürfen exklusiv nur von BO-Marketing durchgeführt werden, die Bürgerinitiative bleibt außen vor.
Die Bürgerinitiative hatte sogar eine alte Zechenlore organisiert, die sie herrichten und der Stadt spenden wollte, damit diese auf dem Platz hätte aufgestellt werden können, Das Stadtteilbüro setzte sich sehr für die Aufstellung ein, doch die selbsternannte „Ermöglicherstadt“ Bochum scheiterte mal wieder am eigenen Anspruch. Die Verwaltung komplizierte das Aufstellungsverfahren derart, dass die Spende der Lore der Bürgerinitiative unmöglich gemacht wurde. Die Stadt wollte die Initiative mittels Vertrag für die Kosten von Instandhaltung und einen späteren Abbau oder eine Umsetzung der Lore in Haftung nehmen. Statt, wie Oberbürgermeister Eiskirch es bei jeder Gelegenheit darstellt, präsentierte sich die Stadt mal wieder nicht als „Ermöglicher“ sondern zeigte die Verwaltung dem OB, dass eine ihrer wahren Stärken im Verhindern liegt. Die Zechenlore ziert jetzt in Wattenscheid-Westenfeld den evangelischen Friedhof. Anders als die Stadt ermöglichte die Kirche eine schnelle und reibungslose Aufstellung. Anschließend wurde gemeinsam mit der Bürgerinitiative eine würdige Einweihungsveranstaltung organisiert. Die Lore erinnert jetzt an die im Steinkohlenbergbau verstorbenen Wattenscheider Bergleute.

Bei den von der Initiative initiierten und mit organisierten Beleuchtungsaktionen des Fördergerüsts bleibt die Stadt so weit wie möglich außen vor. Anderenfalls ist zu befürchten, dass die Verwaltung auch hier noch Mittel und Wege findet diese zu torpedieren.
Die Kritik der Initiative am Zustand des Platzes und der Umgebung wird ignoriert. Die Chance, die Initiative zu unterstützen Veranstaltungen auf dem Platz durchzuführen, wurde vertan. Wer die Stadt deutlich und völlig zu Recht kritisiert, wird aufs Abstellgleis gestellt. Kritikfähig zeigt sich die Verwaltung nicht. Bürgerbeteiligung kann nicht funktionieren, so lange sich die Stadt in der Rolle des Verhinderers gefällt und sich kaum Mühe gibt Dinge zu ermöglichen, die die Menschen aus Wattenscheid vorschlagen und umsetzen möchten.