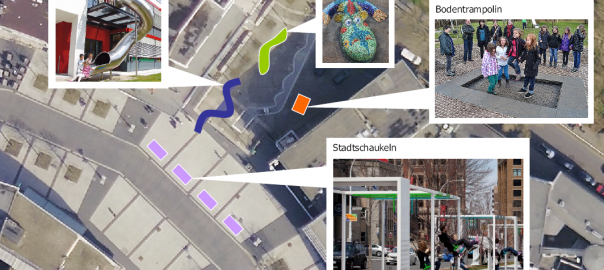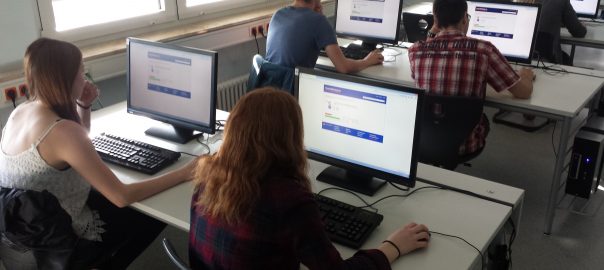Bisher hängt Bochum in Sachen Digitalisierung der Schulen in der analogen Steinzeit fest. Die Stadt hat es bis heute nicht geschafft die Schulen an schnelles Internet anzubinden. Während die Stadt sich als schnellste Stadt Deutschlands “Gigabit-City” abfeiert, können die Bochumer Schüler das Internet mangels Glasfaseranschlüssen an den Schulen wenn überhaupt, nur im Schneckentempo nutzen.
Bochumer Schulen sollen endlich digital werden
Jetzt endlich will die Stadt diesen eklatanten Missstand beseitigen. Insgesamt will die Stadt Bochum in die Digitalisierung der 70 städtischen Schulen (42 Grundschulen an 49 Standorten, zehn Gymnasien, ein Weiterbildungskolleg, fünf Gesamtschulen, zwei Sekundarschulen, zwei Hauptschulen, fünf Realschulen, sieben Förderschulen an acht Standorten, einer Schule für Kranke, fünf Berufskollegs an acht Standorten) 27 Millionen investieren. 18,9 Millionen erhält die Stadt Bochum zu diesem Zweck aus dem Digitalpakt von Bund und Land, weitere 6 Mio. aus dem Förderprogramm Gute Schule NRW.
Um das Geld sinnvoll auszugeben hat der Stadtrat ein Digitalprojekt für die Schulen auf den Weg gebracht (Beschluss 20193159), das aus zwei Teilprojekten besteht, der Herstellung von Breitbandanbindungen der Schulen (Glasfaserausbau) und dem Medienentwicklungsplan.
Der Medienentwicklungsplan besteht aus drei Säulen: 1 Schulische Medienkonzepte, Unterrichtsentwicklung, Fortbildung, 2 Hardwareausstattung, Netzinfrastruktur, 3 Wartung, Support. Die Angaben zur Organisation der Umsetzung und der auf Dauer erforderlichen Wartung der aufgebauten IT-System und des zu erbringenden Supports ist im städtischen Medienentwicklungsplan jedoch stark nachbesserungsbedürftig.
Die Unterstützung der Schulen bei der Umsetzung des Medienentwicklungsplans ist unzureichend
Die Aufgaben des Schulträgers im Rahmen des Medienentwicklungsplans sind überaus umfangreich und vielfältig (Aktivitäten des Schulträgers im Rahmen der Medienentwicklungsplanung). Wie die Schulverwaltung und die Schulen diese Leistungen erbringen wollen, ist dem Medienentswicklungsplan nur ansatzweise zu entnehmen. Dass eine Wahrnehmung der entsprechenden Aufgaben bei 70 Schulen durch nur 6-7 Vollzeitbeschäftigte möglich sein soll, erscheint, selbst wenn viele Aufgaben an externe Dienstleister abgegeben werden sollen, mehr als fraglich. Offenbar soll ein wesentlicher Teil der Aufgaben auf die Schulen verlagert werden.
Die Schulen sollen mindestens zwei 1st-Level-Beauftragte benennen, die dann zuständig dafür sein sollen, dass die IT-System der Schule ständig aktualisiert und um neue Angebote erweitert werden. Die Beauftragten sollen als Multiplikatoren alle Lehrenden auf die neu installierten IT-Systeme und das Serveradministrationssystem vor Ort einweisen.
Im Rahmen des Medienentwicklungsplans sollen die Schulen dafür Sorge tragen, dass die verfügbaren digitalen Möglichkeiten in die schulische Programmarbeit inklusive der Qualitätssicherung integriert werden. Dazu verpflichten sich die Grundschulen die Medienkompetenz auf der Basis des Medienpass NRW zu vermitteln, die weiterführenden Schulen entlang des Medienkonzepts zu unterrichten und das alles anhand der üblichen Unterrichtsdokumentationen festzuhalten. Dass das in der beabsichtigten Weise geschieht, wird ebenfalls Aufgabe des 1st-Level-Beauftragten sein. Dazu müssen noch die erforderlichen Fortbildungen im Bereich der Digitalen Medien organisiert werden.
Es stellt sich die Frage, gibt es an allen Schulen überhaupt genug Lehrende, die die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen besitzen diese Aufgaben zu übernehmen? Gibt es an den Schulen Lehrkräfte, die diese umfangreichen Tätigkeiten, neben ihrer tagtäglichen Arbeit, quasi noch nebenbei noch erledigen können? Dass kann bezweifelt werden. Die Schulen sind sich vermutlich noch gar nicht bewusst, welche Arbeit da auf sie zurollt.
Zwar ist es sinnvoll, dass an den Schulen umfangreiche Kompetenzen im Umgang mit den neuen digitalen Geräten und Medien bestehen, damit diese viele IT-Angelegenheiten auch ohne die Hinzuziehung Dritter eigenständig erledigen und lösen können, doch dürfen die Schulen auch nicht überfordert werden. Sonst bleiben Geräte und Medien ungenutzt stehen, weil den Lehrenden die Kompetenzen im Umgang damit fehlen, bzw. sie davor zurückschrecken im Hilfefall auf Unterstützung zurück zu greifen, wenn der entsprechende Support nicht so organisiert ist, dass er zuverlässig, schnell und kompetent die verschiedensten Problemstellungen lösen kann.
Die Schulen benötigen Unterstützung von einem städtischen IT-Kompetenzzentrum
Die Schulen brauchen also eine starke zentrale IT-Unterstützung. Das bietet in vielen Städten ein kommunales Medien- oder IT-Kompetenzzentrum . Ein IT-Kompetenzzentrum übernimmt die Verwaltung Strategie und Steuerung der Medienentwicklung, sowie Finanzmanagement, es betreut die gesamte IT-Technik der Schulen und übernimmt dabei das IT-Operationsmanagement Konfigurationsmanagement Sicherheitsmanagement Lizenzmanagement Verfügbarkeitsmanagement. Es ist ebenfalls zuständig für die IT-Verwaltung, die Beschaffung, das Änderungs- und Release-Management, sowie Wartung und Support und die Störungsbearbeitung wie das Service-Level-Management. Ein IT-Kompetenzzentrum ist darüber hinaus der ideale Partner, wenn es um die Förderung der Medienkompetenz der Schülerinnen und Schüler geht. Durch die Bereitstellung aktueller audiovisueller Bildungsmedien, durch Beratungs- und Fortbildungsangebote für Lehrerinnen und Lehrer und durch aktive Medienarbeit für Schülerinnen und Schüler unterstützen sie das Lernen mit und über Medien.
Für diese umfangreichen Aufgaben werden 6-7 Mitarbeiter nicht ausreichen. Insgesamt sollen an den Bochumer Schulen fast 12.500 Endgeräte angeschafft werden, dazu entsprechend viele Beamer, Drucker, Vernetzungsequipment, Kameras und viele weitere fachspezifisch einsetzbare IT-Geräte, z.B. für den Physikunterricht. Bisher haben alle in diesem Bereich beim Schulverwaltungsamt tätigen Mitarbeiter eine Verwaltungsausbildung, viel wichtiger ist aber, dass die Mitarbeiter hohe Qualifikationen im IT-Bereich besitzen.
Wie sollte ein IT-Kompetenzzentrum organisiert sein?
Ein städtisches IT-Kompetenzzentrum ist ein Dienstleister, auf den die Schulen für jedweden Support und erforderliche Fortbildungen schnell und zuverlässig zurückgreifen können. Der reibungslose und zeitnahe Erledigung von IT-Problemen ist für einen modernen digitalen Schulunterricht unabdingbar. Dass Schulen, wie heute, teilweise wochenlang auf die Behebung von Fehlern bei IT-Geräten warten müssen, ist nicht hinnehmbar. Kann der Fehler nicht binnen Tagesfrist behoben werden, muss ein Ersatzgerät verfügbar sein oder bereitgestellt werden.
Das städtische IT-Kompetenzzentrum sollte weitgehend selbständig und unabhängig vom Schulverwaltungsamt arbeiten. Die Schulen, für die das Zentrum tätig ist, sollten bei der Organisation der Aufgaben und Tätigkeiten des Zentrums eng eingebunden werden. Zu überlegen wäre, ob das Zentrum nicht besser bei der Wirtschaftsentwicklung, die auch beim Breitbandanschluss der Schulen federführend ist, als beim Schulverwaltungsamt angegliedert werden sollte. Die Strukturen bei der WEG sind deutlich flexibler, mehr IT- und serviceorientiert aufgebaut als die, die bei städtischen Ämtern der Verwaltung vorzufinden sind. Auch ist zu überlegen, ob ein städtisches IT-Kompetenzzentrum nicht gemeinsam mit benachbarten Städten betrieben werden kann. Um so größer das IT-Kompetenzzentrum und um so mehr Schulen betreut werden, desto mehr kompetente Mitarbeiter können umso flexibler eingesetzt werden. Der Service wird besser, während die Kosten sinken.
Der Medienentwicklungsplan sollte also zügig durch ein städtisches IT-Kompetenzzentrum erweitert werden.