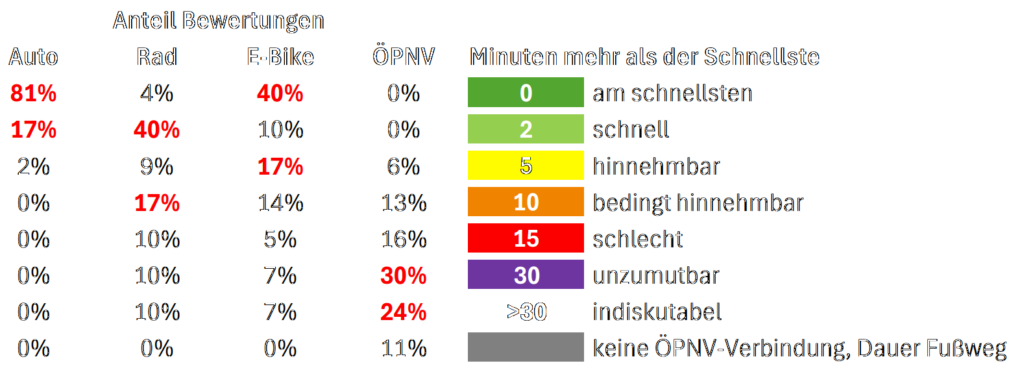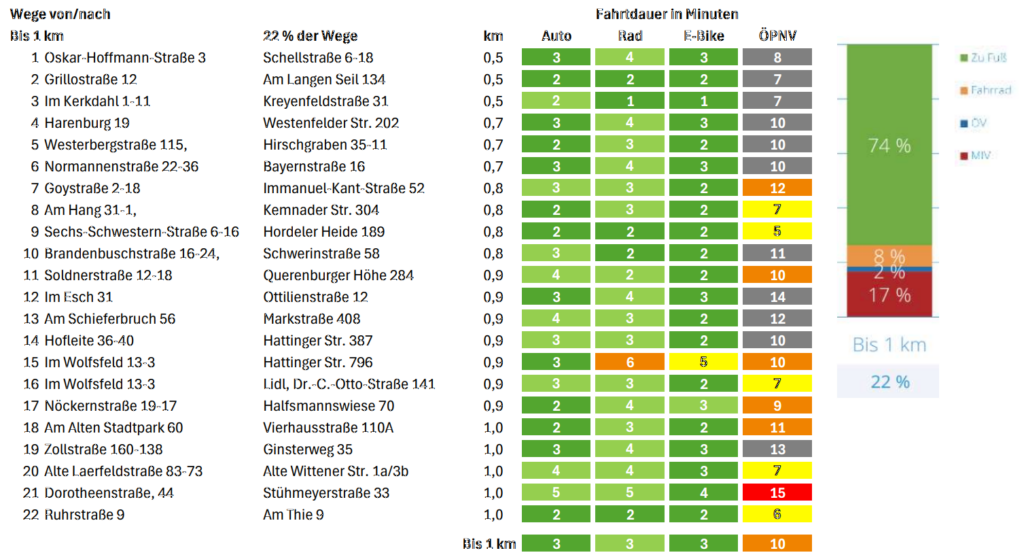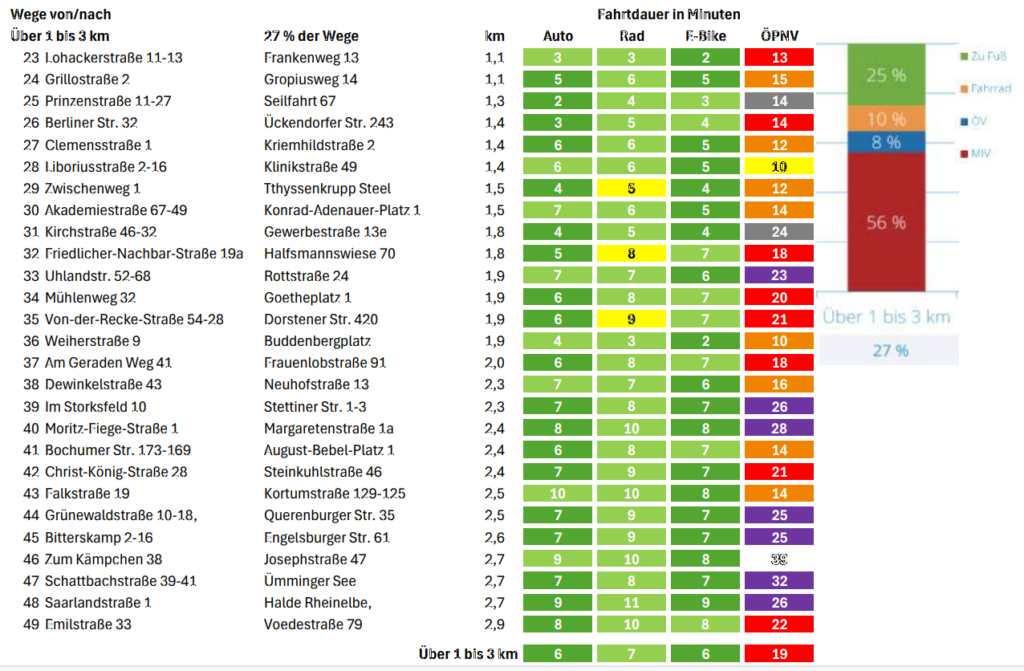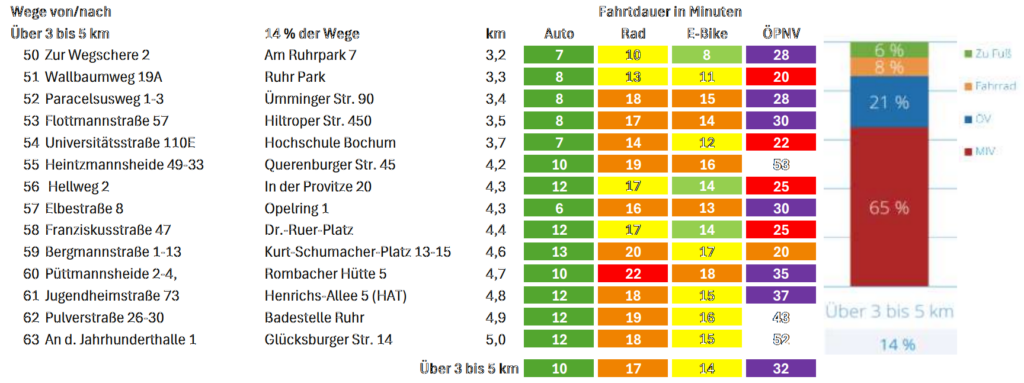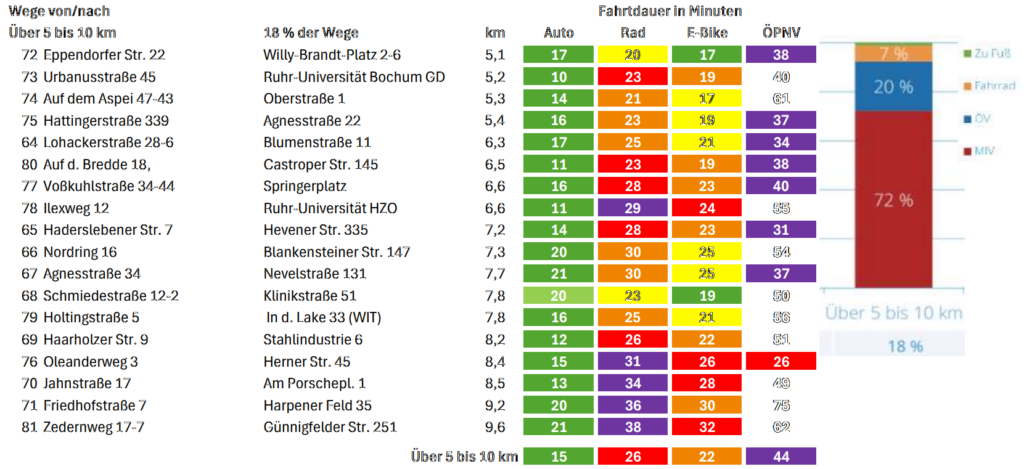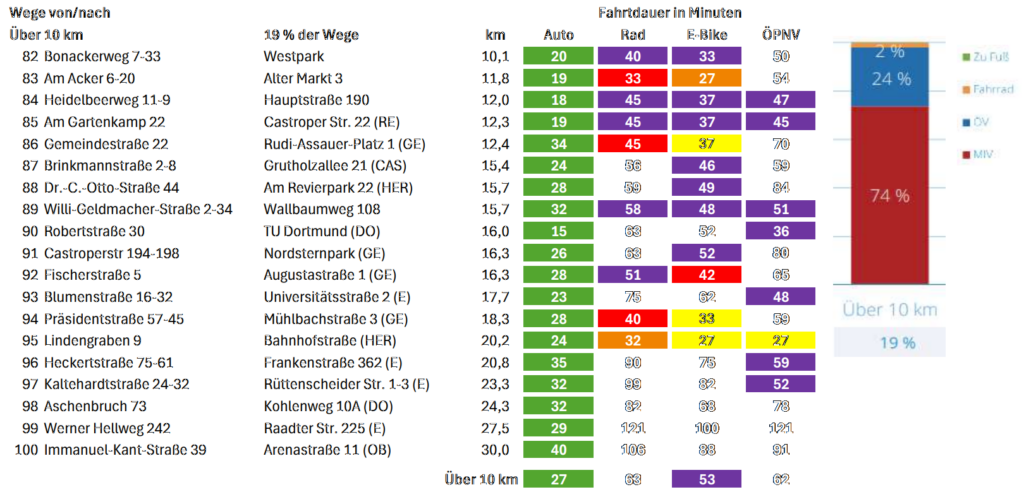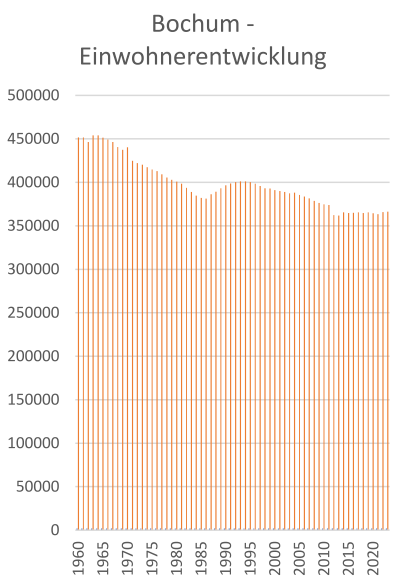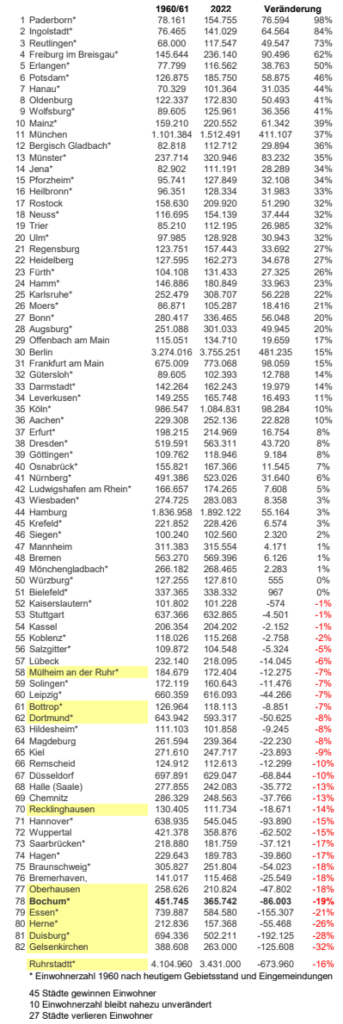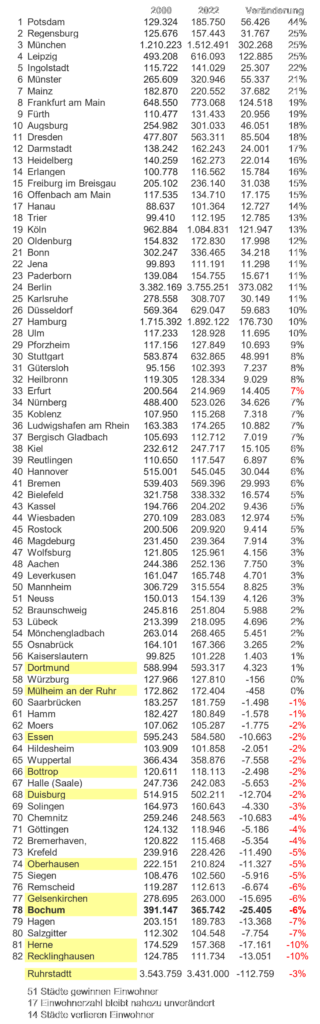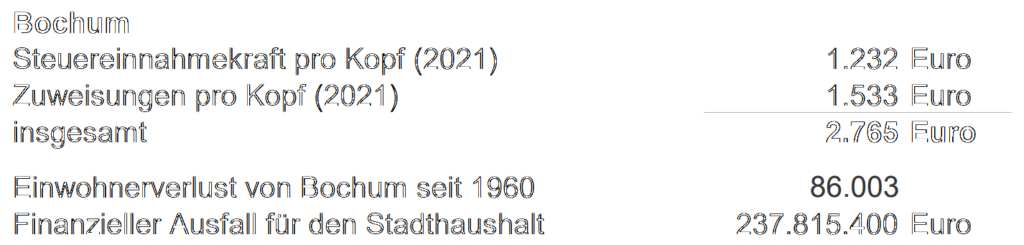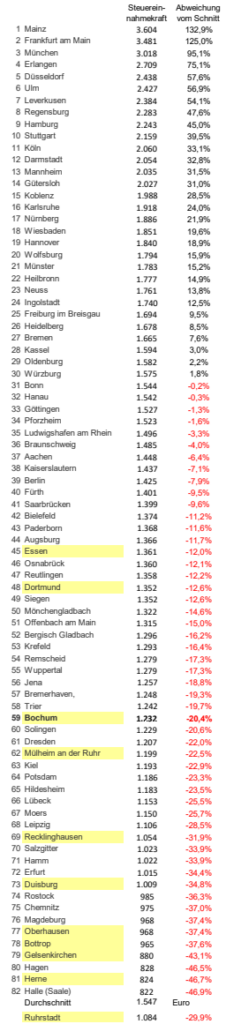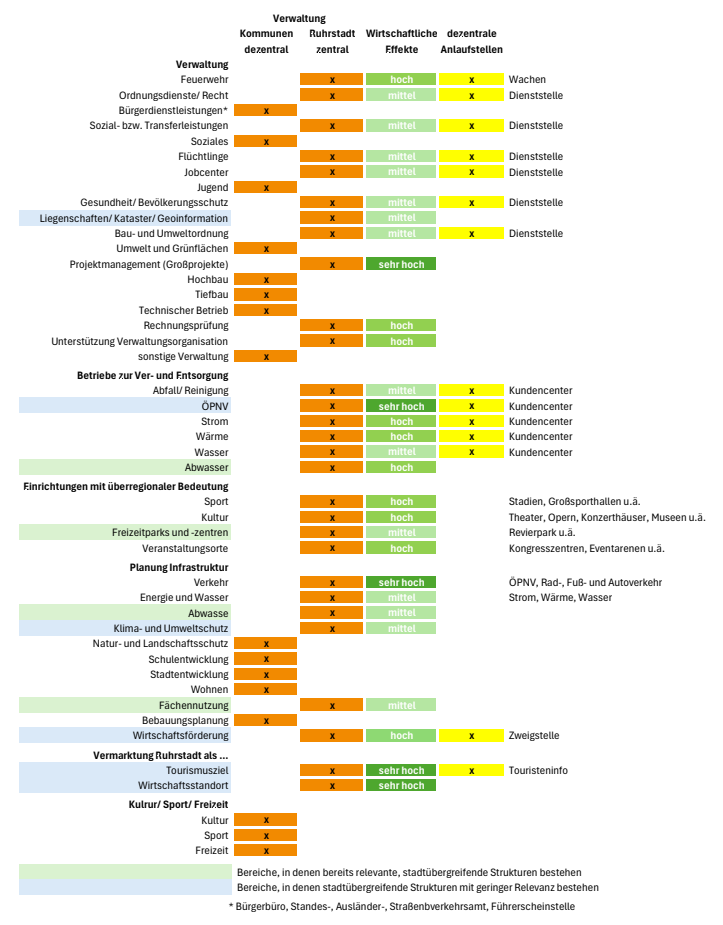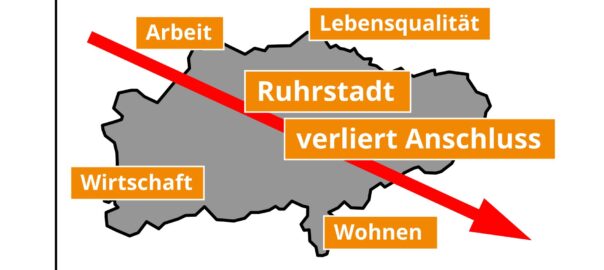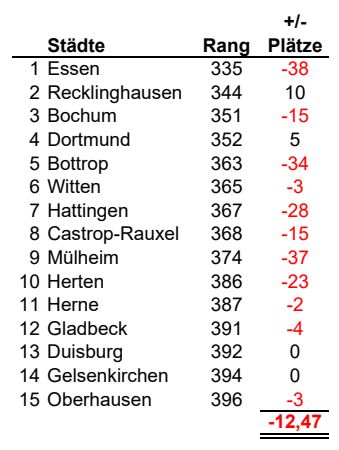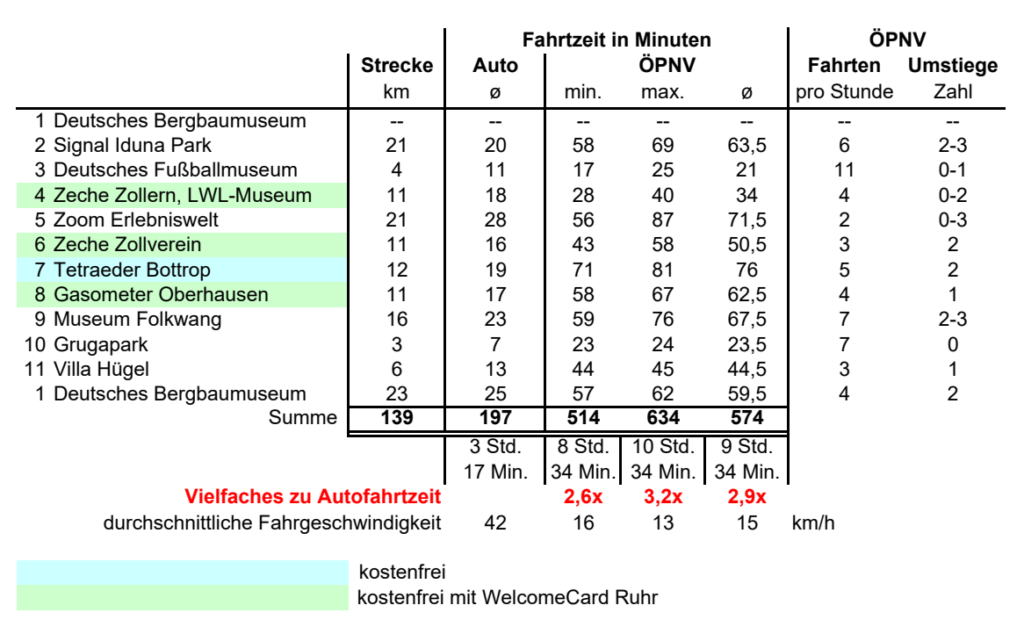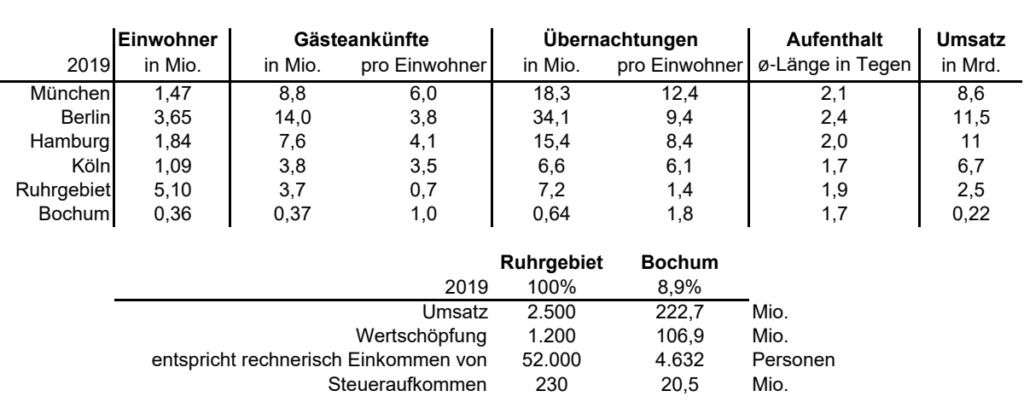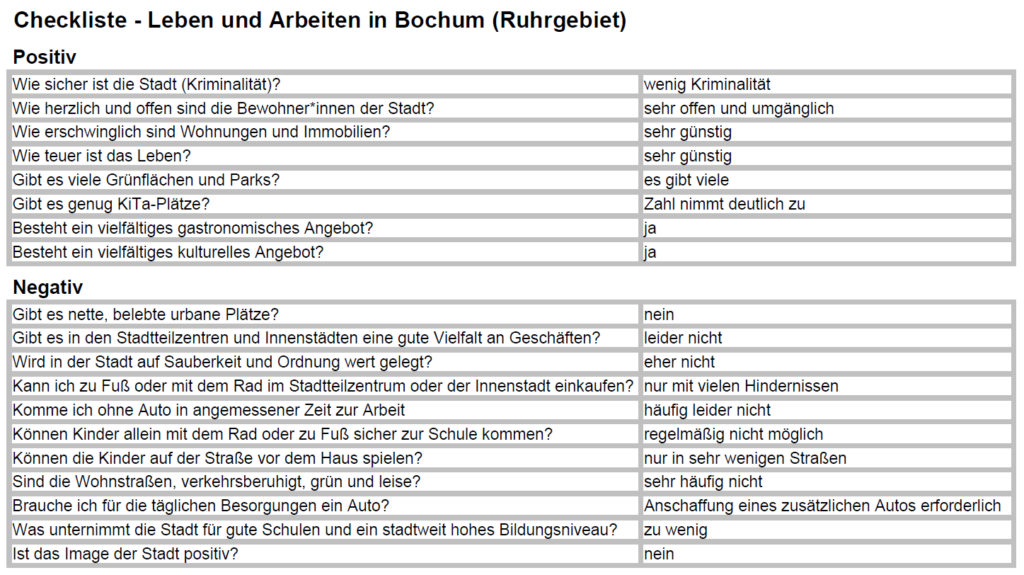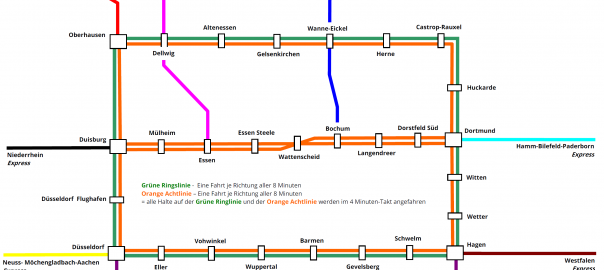Mehr Sauberkeit durch die Abschaffung aller öffentlichen Mülleimer?

Warum ist das Ruhrgebiet an vielen Ecken so vermüllt und japanische Städte blitzsauber? Liegt es daran, dass es in Japan keine öffentlichen Abfallbehälter gibt? Könnte das auch in Bochum funktionieren?
Wer aus Japan zurück ins Ruhrgebiet kommt, dem fällt besonders deutlich auf wie vermüllt und verdreckt die Städte hier sind (Sauber, ordentlich, gut gepflegt und ansehnlich: Vier Faktoren für ein attraktives Stadtbild). In japanischen Städten liegt so gut wie kein Müll auf den Straßen, in den Grünanlagen, Parks oder an Gleisanlagen, während er bei uns fast überall unschön ins Auge sticht. Auch Graffiti-Schmierereien gibt es in Japan keine. Dazu sind blitzsaubere öffentliche Toiletten an jeder Ecke in japanischen Städten eine Selbstverständlichkeit. Bei uns dagegen gibt es davon viel zu wenige (Fehlende Toiletten in Bochum – Lösung: autarke Trockentoiletten), die sich dann oft noch in einem kaum benutzbaren Zustand befinden. Damit stellt sich die Frage, was läuft in Japan warum besser und was können wir von dort lernen?

Japan, das Land ohne öffentliche Mülleimer
Dazu gibt es noch einen weiteren erstaunlichen Unterschied zwischen japanischen Städten und denen des Ruhrgebiets: Im öffentlichen Raum findet man keine Abfallbehälter. Allenfalls bei öffentlichen Großveranstaltungen werden provisorische Mülleimer bereitgestellt. Sonst ist es für die Menschen selbstverständlich Müll, den sie machen, wieder mit nach Hause zu nehmen und dort zu entsorgen. Das gilt sogar für die Hinterlassenschaften der vierpfotigen Haushaltsbewohner.
Nach dem Giftgasanschlag der Aum-Sekte 1995 wurden in Japan alle öffentlichen Mülleimer abgeschafft. Mit dem überraschenden Ergebnis, dass es nicht dreckiger, sondern noch sauberer wurde (Das Verschwinden der Mülleimer). Die Erkenntnis in Japan: Mülleimer erzeugen Müll, je mehr Mülleimer aufgestellt werden, um so mehr Müll wird entsorgt. Die Kapazität reicht nie. Es gibt immer irgendwo Abfallbehälter, die überquellen. Fehlt ein Mülleimer da, wo er erwartet wird, entsteht ein Müllablageplatz. Phänomene, die auch in Bochum, besonders in städtischen Grünanlagen zu beobachten sind.
Warum ist es in Japan ohne Mülleimer sauberer?
Doch so einfach wie es auf den ersten Blick scheint, “Keine Mülleimer mehr, kein Müll mehr in der Stadt,” ist es dann doch nicht. Auch bei der Haltung zur Stadt und zur Sauberkeit gibt es deutliche Unterschiede zwischen Japan und Deutschland: Menschen in japanischen Großstädten fühlen sich für die Sauberkeit in der Stadt direkt selbst verantwortlich. Bei uns im Ruhrgebiet hat man das Sauberhalten der Städte an städtische Betriebe delegiert, die bezahlt man von seinen Steuern und Abgaben und die werden damit als verantwortlich für Sauberkeit angesehen. Bei uns gibt es jemanden, der für die Sauberkeit, die die Stadtbewohner und –bewohnerinnen erwarten, bezahlt wird, in japanischen Städten sehen sich die Menschen zunächst man selbst für die Sauberkeit der Stadt und öffentlicher Einrichtungen verantwortlich.
Es beginnt in den Schulen …
Das beginnt bereits in der Schule. Es sind die Schülerinnen und Schüler, die die Schule sauber halten. Sie übernehmen einen Großteil der Reinigungsarbeiten, an manchen Schulen sogar die Toilettendienste. Aufgrund der extremen Sauberkeit der Schulen, hält sich der Reinigungsdienst 20 Minuten viermal die Woche zeitlich in Grenzen (Sollten Kinder ihre eigenen Schulen putzen? Japan denkt ja.). Die Schulkinder lernen, dass es besser ist, alles sauber und ordentlich zu halten, wenn Sie diejenige sind, die das Chaos und den Schmutz, für den sie selbst gesorgt haben, wieder aufräumen und putzen müssen. Auch das Schulessen bereiten die Schülerinnen und Schüler selbst zu und verteilen es auch. Den Kindern wird von der ersten Klasse an vermittelt, dass sie selbst für eine saubere Schule und gutes Essen verantwortlich sind und nicht andere, die die Arbeit für sie machen, da man sie dafür bezahlt.
Selbst Verantwortung übernehmen
Auch sieht man in japanischen Städten regelmäßig Gruppen von ehrenamtlichen Saubermachern, die in ihren Nachbarschaften Müll aufsammeln. Ein Stadtputz, der in Bochum jedes Frühjahr durchgeführt wird (Frühjahrs-Stadtputz am 5. April 2025), wird oft monatlich oder sogar wöchentlich organisiert.
In japanischen Städten gilt der Grundsatz: “Wer in einer sauberen Stadt leben möchte, muss seinen Teil dazu beitragen.” Wie man besonders dem Ruhrgebiet und auch Bochum ansieht, ist dieses Verständnis bei uns nicht weit verbreitet. Man erwartet, dass die Stadt sich kümmert und sieht sich in keiner Verantwortung. Die Erwartungen und Forderungen an die Stadt sind groß, die Bereitschaft Gegenleistungen zu erbringen, oft kaum bis gar nicht vorhanden. Die Stadt wird als Dienstleister gesehen, die für einen alle Aufgaben erledigt. Man sieht sich nicht als Teil einer Stadtgesellschaft oder Gemeinschaft, in der jede und jeder seinen Beitrag leisten muss, damit Dinge wie Sauberkeit und Ordnung funktionieren.
Die Menschen, die in der Stadt leben, sind das Maß der Dinge
Aber noch ein weiterer Punkt ist entscheidend für die besondere Sauberkeit japanischer Städte. Die besondere Detailverliebtheit, Verantwortlichkeit und Kundenorientierung, die die japanische Gesellschaft auszeichnet. Auch in japanischen Städten werden Reinigungsarbeiten größtenteils von Unternehmen erledigt. Die Erwartungen der Einwohnerinnen und Einwohner als “Kunden” haben jedoch einen ganz anderen Stellenwert als bei uns. Eine Toilette, eine Straße oder eine öffentliche Einrichtung nur rudimentär zu reinigen, wäre undenkbar. Es wird immer die maximale Sauberkeit angestrebt, da diese von den Kunden, für die man arbeitet, erwartet wird.
Was die Menschen, die in der Stadt leben, wünschen und erwarten, hat bei uns dagegen nur bedingt mit dem zu tun, was die städtischen Betriebe bieten. Bei uns werden die Bedürfnisse der Kunden den Belangen der öffentlichen Betriebe und Beschäftigten untergeordnet. Es reicht, wenn die Toilette oder der Bahnhof nach einer Reinigung irgendwie sauberer ist als vorher. Dass die Menschen, die die Einrichtungen nutzen, sich im Hinblick auf den Sauberkeitsstandard oft deutlich mehr wünschen, als geleistet wird, interessiert nicht. Sie haben sich nach dem zu richten, was die öffentlichen Betriebe bereit sind zu leisten.
Entscheidend ist die Einstellung der Menschen
Abfallbehälter im öffentlichen Raum abschaffen und schon wird es in der Stadt sauberer, das wird also bei uns nicht funktionieren. Solange die Haltung, dass man als Teil der Stadtgesellschaft zunächst selbst für die Sauberkeit der Stadt verantwortlich ist und seinen Teil zur Müllfreiheit der Stadt beizutragen hat, nicht gesellschaftlich verankert ist, bleiben die öffentlichen Mülleimer unverzichtbar.
Das Beispiel Japan zeigt allerdings, wer eine saubere Stadt möchte, muss zunächst die Einstellung der Menschen zu ihrer Stadt ändern und das von klein auf. Der jährliche Bochumer Stadtputz ist dazu ein guter Anfang. Es sollte allerdings viel mehr Aktionen geben, die Menschen dazu zu bewegen, sich für die Sauberkeit ihrer Stadt aktiv zu engagieren. Wie in Japan müsste dazu die Bereitschaft, Verantwortung für die Sauberkeit der eigenen Stadt und Schule zu übernehmen, bereits in den Schulen intensiv gefördert werden. Erst wenn bei allen Bewohnern und Bewohnerinnen der Stadt die Einsicht vorhanden ist, dass zunächst mal die für die Beseitigung des Mülls verantwortlich sind, die ihn selbst machen, wird man die öffentlichen Mülleimer abschaffen können.
Was man langfristig tuen könnte
Zu überlegen wäre, dass die Stadt sich langfristig das Ziel setzt, Schritt für Schritt die Abfallbehälter in der Öffentlichkeit abzubauen und sie konsequent und immer wieder die Menschen dazu auffordert, jeden Müll selbst zu entsorgen, damit dieses Ziel erreicht werden kann. Bereits die Entscheidung, dass man als Stadt die öffentlichen Abfallbehälter auf lange Sicht abschaffen möchte, könnte ein erster Schritt sein die Einstellung der Menschen zu ändern und sie dazu anregen, über das Thema Sauberkeit in der Stadt nachzudenken und darüber zu diskutieren, was der Beitrag sein sollte, den sie selbst leisen könnten, um das Ziel zu erreichen.