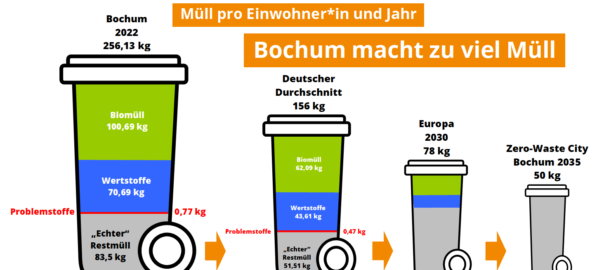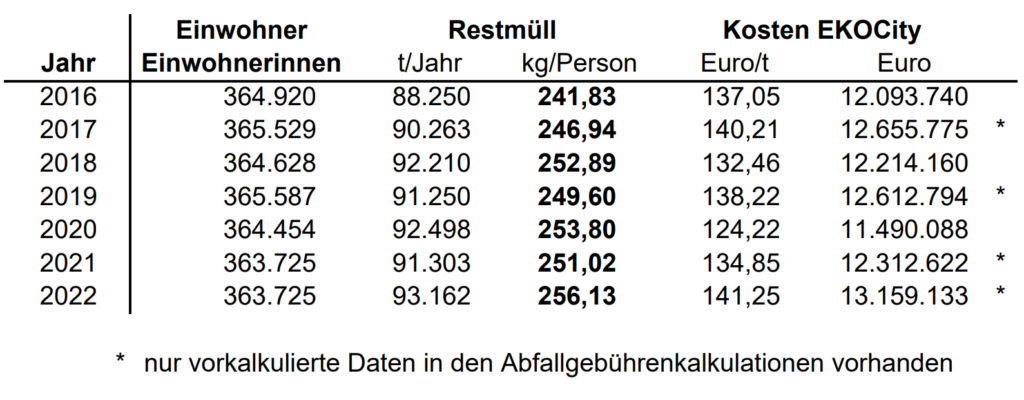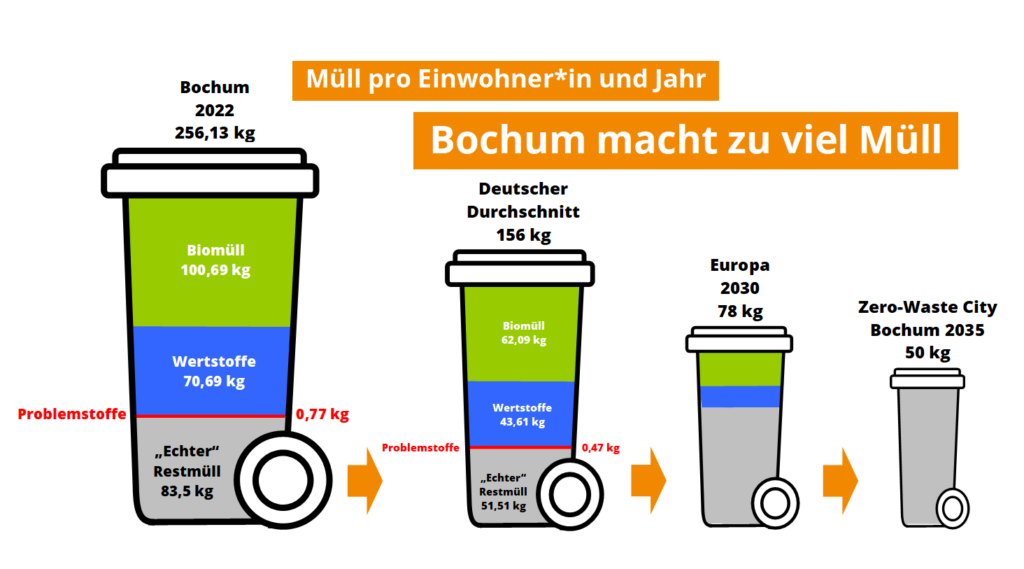Politik ist mit der Aufsicht von städtischen Unternehmen überfordert

Eigentlich sollen die Politiker und Politikerinnen des Stadtrates, die städtischen Unternehmen überwachen und beraten. Doch das gelingt oft nicht, wie die schwere wirtschaftliche Schieflage der BOGESTRA, die Beinahe-Insolvenz der SBO (Seniorenheime) sowie die teuren Fehlinvestitionen der Stadtwerke zeigen. Was sind die Gründe? Was muss sich ändern?
Aufgrund von Fehlern der Unternehmensleitung kam es bei den städtischen Seniorenheimen (SBO Senioreneinrichtungen Bochum gGmbH) zwischen 2012 und 2024 zu Verlusten von 33,8 Mio. Euro (WAZ vom 19.03.25). Ende 2022 stand das Unternehmen vor der Insolvenz, ehe die Betreibergesellschaft der Seniorenheime von der Stadt gerettet wurde. Seitdem läuft die Sanierung. Die BOGESTRA ist ebenfalls ein Sanierungsfall, die Verluste betragen mittlerweile 90 Mio./ Jahr, die Schulden insgesamt 308 Mio.. Gleichzeitig sinkt die Zahl von jenen, die den ÖPNV nutzen. Das Angebot ist weit entfernt von zeitgemäß (BOGESTRA wird zum Sanierungsfall). Die Lage gerät zunehmend außer Kontrolle. Die Stadtwerke sind in der Vergangenheit durch Fehlinvestitionen aufgefallen, die die Stadt insgesamt einen dreistelligen Millionenbetrag gekostet hat (Führungswechsel bei den Stadtwerken).
Wie konnte es zu den Fehlentscheidungen bei den städtischen Unternehmen kommen?
Es fragt sich, wie konnte und kann das passieren? Gesellschafter der städtischen Unternehmen ist die Stadt und damit die Bürgerinnen und Bürger, sie sind quasi die Aktionäre von Unternehmen wie Stadtwerken, BOGESTRA, USB, VBW, WEG und SBO.
Die Stadtpolitiker und -politikerinnen wurden gewählt, die Unternehmensführung zu überwachen und zu beraten. Die Mitglieder des Rates sollen sicherstellen, dass die Unternehmen im Sinne der Menschen arbeiten, die in der Stadt leben und nicht in wirtschaftliche Schieflage geraten. Wie die genannten Beispiele zeigen, gelingt das zu oft nicht. Unternehmerische Fehlentscheidungen bleiben unerkannt und werden nicht vorausschauend verhindert. Drohendes Unheil wird nicht rechtzeitig abgewendet. Die Unternehmensführungen arbeiten weitgehend ohne wirksame politische Kontrolle.
Das hat insbesondere drei Gründe:
- Den Mitgliedern des Stadtrates fehlen Rechte, die eine effektive Kontrolle ermöglichen.
- Die Strukturen der Kontrollgremien verhindern eine wirkungsvolle Kontrolle.
- In den Kontrollgremien fehlt die notwendige Kompetenz für eine sachdienliche Überwachung und Beratung der Unternehmensführung.
Regelmäßig erfolgt die Kontrolle der städtischen Unternehmen allein durch die Aufsichtsräte, im Ausnahmefall, bei der SBO Senioreneinrichtungen Bochum gGmbH, gibt es noch eine Gesellschafterversammlung.
Welche Kontrollmöglichkeiten hat der Stadtrat?
Bürgerinnen und Bürger wählen die Mitglieder des Stadtrates, als ihre Vertreter und Vertreterinnen in den Stadtrat. Doch im Rat werden nur wenige grundlegende Entscheidungen, die die städtischen Unternehmen betreffen, getroffen. Der Stadtrat trifft insbesondere Beschlüsse über Jahresabschluss und Wirtschaftsplan, die Besetzung der Geschäftsführungs- und Vorstandsposten sowie Entscheidungen, mit denen die Struktur der Unternehmen grundlegend verändert werden soll, z.B. Kauf und Verkauf von Tochtergesellschaften oder Satzungsänderungen. An den strategischen unternehmensinternen Entscheidungen insbesondere über die Entwicklung des Unternehmens sowie den wesentlichen Investitions- und Finanzentscheidungen ist der Stadtrat dagegen nicht beteiligt.
Dafür wählt der Stadtrat Mitglieder des Stadtrates in die Aufsichtsräte der städtischen Unternehmen. Diese haben die Aufgabe die Unternehmensführung zu beraten und die Unternehmensentscheidungen zu überwachen bzw. die Unternehmen im Sinne der Stadt mit zu lenken.
Welche Defizite bestehen in den Aufsichtsgremien?
Ämterhäufung – Bei allen großen und wichtigen städtischen Unternehmen ist der Oberbürgermeister der Aufsichtsratsvorsitzende. Fraglich ist schon, ob es einer einzige Person neben seiner Tätigkeit als Chef der Stadt und Stadtverwaltung möglich ist, noch in 33 weiteren Gremien Funktionen als Mitglied oder Vorsitzender so umfassend und tiefgehend auszufüllen, wie es nötig wäre (WAZ vom 04.04.25).
Fehlendes Gewicht im Aufsichtsrat – Auch sitzen in den Aufsichtsratsgremium nicht nur die Vertreter und Vertreterinnen der Bürger und Bürgerinnen, sondern zusätzlich Vertreter und Vertreterinnen der Beschäftigten, das sind bei den Stadtwerken 5 von 15, bei der BOGESTRA 6 von 12 und bei der SBO 3 von 9 Mitgliedern. Obwohl eigentlich die Bedürfnisse der Menschen, die in der Stadt leben im Mittelpunkt der Tätigkeit der städtischen Unternehmen stehen sollten, sind es bei städtischen Unternehmen nicht selten eher die Interessen der Beschäftigten.
So sind im ÖPNV und bei der BOGESTRA höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen ständig ein Thema, ein metropolengerechter Ausbau des ÖPNV, eine Ausweitung des Liniennetzes, besserer Service oder ein kundenfreundliches Ticket- und Fahrpreissystem dagegen offensichtlich nicht, sonst sähe das ÖPNV-Angebot in Bochum, Gelsenkirchen, Witten und dem Ruhrgebiet anders aus. Bei einem zwischen städtischen Gesellschaftern und Beschäftigten paritätisch besetzten Aufsichtsrat ist eine andere Prioritätensetzung allerdings auch kaum zu erwarten.
Fehlende Kompetenzen – Hinzu kommt, dass vielen Mitgliedern der Aufsichtsräte, die die Politik entsendet, nötige fachliche Kompetenzen fehlen, die unverzichtbar sind, um die Unternehmensführung wirksam kontrollieren oder gar beraten zu können.
Eine Berufsausbildung als Psychotherapeutin oder Maschinenschlosser z.B. befähigt nicht, die komplexen wirtschaftlichen, juristischen und finanziellen Grundlagen der Unternehmensführung der BOGESTRA nachvollziehen und bewerten zu können. Auch ermöglichen es diese Ausbildungen nicht, sich mit den Besonderheiten im Geschäftsfeld der BOGESTRA, dem öffentlichen Personennahverkehr auszukennen. Das bedeutet, im Ergebnis bringen nur maximal vier von zwölf Mitgliedern des Aufsichtsrats der BOGESTRA, jene Qualifikationen mit, die zur Ausübung eines Amtes im Aufsichtsrat zum Wohle der Stadt eigentlich unverzichtbar sind.
Fehlende Kontrollmöglichkeiten – Bedenklich ist auch, dass die Aufsichtsratsgremien überwiegend von den drei großen Parteien (SPD, Grüne und CDU) besetzt werden. Nur vereinzelt sind andere politische Gruppierungen in den Aufsichtsräten vertreten, bei der BOGESTRA beispielsweise gar nicht.
Damit ist eine Kontrolle der Unternehmen durch den gesamten Stadtrat nicht mehr möglich, denn auch ein Akteneinsichtsrecht bezüglich Angelegenheiten der Unternehmen, haben die Mitglieder des Stadtrates, anders als gegenüber der Verwaltung, nicht. Parteien oder Wählergemeinschaften, die nicht in einem Aufsichtsgremium vertreten sind, haben keine Chance an Informationen zu kommen, die für eine Kontrolle erforderlich wären.
Eine effektive Kontrolle ist aktuell nicht möglich
Die Unternehmensführung der städtischen Unternehmen mit nur maximal zwei Hand voll ehrenamtlich tätigen, oft fachlich kaum versierten Kommunalpolitikern und -politikerinnen überwachen zu wollen, die dazu ganz überwiegend aus den Parteien kommen, die auch im Rat die Mehrheit und damit eher begrenztes Interesse an Kontrolle haben, kann nicht funktionieren.
Es ist also nicht verwunderlich, wenn die Aufsichtsräte immer wieder, ohne diese wirklich zu hinterfragen, Verträge und Geschäfte abnicken, die sich am Ende als fatal für die städtischen Unternehmen herausstellen. So ist es bei den Kraftwerks- und Windparkfehlinvestitionen der Stadtwerke ebenso passiert, wie bei den überteuerten Anmietungen der Seniorenheime bei der SBO und dem Fehlkauf von Straßenbahnen (Baureihe NF6D) der BOGESTRA ohne die üblichen Gewährleistungen zu vereinbaren.
Welche Maßnahmen sind nötig, damit die Politik ihre Kontrollaufgabe erfüllen kann?
Eine wirksame Überwachung und Beratung, wie vom Gesetzgeber eigentlich vorgesehen, wird erst möglich, wenn die Aufsichtsgremien so organisiert werden, dass sie den Mitgliedern die Erfüllung ihrer Aufgaben ermöglicht.
Das bedeutet, die Aufsichtsgremien von städtischen Unternehmen und Einrichtungen mit mehr als 200 Beschäftigten sollten nach folgenden Anforderungen organisiert werden:
- Es sollte jeweils ein Aufsichtsrat wie eine Gesellschafterversammlung eingerichtet werden.
- Ein Aufsichtsrat sollte mindestens 15 Mitglieder besitzen, davon maximal ein Drittel Arbeitnehmervertreter bzw. -vertreterinnen.
- In der Gesellschafterversammlung sollte jede Fraktion des Stadtrats vertreten sein, sowie ein Vertreter oder eine Vertreterin für alle übrigen im Rat vertretenen politischen Gruppierungen.
- Das Akteneinsichtsrecht der Ratsmitglieder und Fraktionen sollte sich ebenfalls auf die städtischen Unternehmen erstrecken.
- Die im Rat vertretenen Parteien und Wählergruppierungen verpflichten sich, für Aufsichtsgremien der großen städtischen Unternehmen nur Personen zu benennen, die berufliche Qualifikationen in juristischer bzw. wirtschaftlicher Hinsicht nachweisen können, vertiefte Erfahrungen in Sachen Unternehmensführung besitzen oder über besondere Kompetenzen aus dem Bereich verfügen, in dem das Unternehmen tätig ist.
- Der Oberbürgermeister bzw. die Oberbürgermeisterin sollte nur eine begrenzte Zahl Aufsichtsmandate ausüben. Möglich wäre z.B. eine Begrenzung auf fünf Mandate.