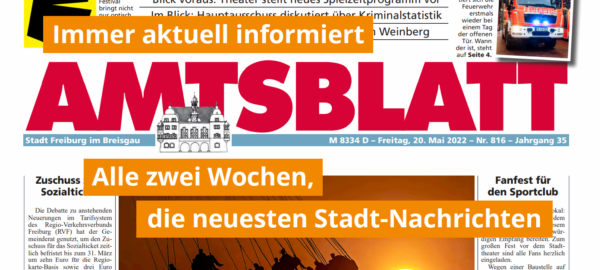Wahlkampfberichterstattung in Bochum – Brauchen wir noch Redakteure oder kann das auch ChatGPT?

Nur noch vier Wochen sind es bis zur Kommunalwahl. Seit einer Woche kann man im Rathaus seine Stimme abgeben. Gut über die Wahl informiert sind die Menschen in Bochum nicht. Die Lokalpresse wird ihrer Aufgabe nicht gerecht.
Wie sollte eine qualitativ hochwertige Berichterstattung im Vorfeld einer Kommunalwahl aussehen? Ziel der Lokalpresse sollte sein, den Lesern und Leserinnen bzw. den Hörern und Hörerinnen eine gute und umfassende Informationsgrundlage zu geben, auf der sie eine fundierte Wahlentscheidung treffen können.
Alle Stimmberechtigten sollten frühest- und bestmöglich darüber informiert werden, welche Parteien und Wählergemeinschaften zur Wahl stehen. Es sollte berichtet werden, was die politischen Gruppierungen für die Stadt tun möchten. Welche Positionen vertreten sie in wichtigen Stadtthemen und welche Konzepte und Pläne haben sie für die Stadt entwickelt? Wo sind die Unterschiede? Sind die Ideen der Parteien und Wählergemeinschaften real umsetzbar, in anderen Städten erfolgreich und geeignet die Probleme in Bochum anzugehen? Basieren die Positionen auf Fakten oder sind sie populistischerer Natur?
Analysen zur letzten Wahlperiode, wo steht die Stadt heute?
Logischer Ausgangspunkt für eine solche Berichterstattung wäre eine Analyse darüber, was in der vergangenen Wahlperiode geleistet wurde. Was ist gut gelaufen, was schlecht. Wer ist für welche politische Entscheidung verantwortlich gewesen? Wie stand die Stadt im Vergleich zu anderen Großstädten 2020 dar, wie ist es heute, fünf Jahre später. Ebenfalls wäre zu analysieren, wo die Menschen in der Stadt Probleme sehen, welche Wünsche sie an die Politik haben und wie die Stadt von außen gesehen wird.
Guten Journalismus zeichnet eine Einordnung der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lage der Stadt aus. Wo steht die Stadt bei Stadtentwicklung und Strukturwandel? Wo gibt es Defizite, Nachholbedarf, wo hinkt man den Entwicklungen in Deutschland und Europa hinterher, wo ist die Stadt Vorreiter.
Journalistische Aufarbeitung und Einordnung der Positionen und Pläne
Dazu kommt kritisches Nachfragen zu Zielen und Positionen, die die politischen Gruppierungen im Wahlkampf verkünden. Konkret: Wird zum Beispiel Klimaneutralität bis 2035 versprochen, wäre zu fragen, ob das überhaupt noch realistisch erreicht werden kann. Und warum die entsprechende Partei nicht in den letzten 5 Jahre die Weichen dafür gestellt hat, dass das Ziel erreicht werden kann.
Auch sind Kontroversen wichtig. Kandidaten verschiedener politischer Farben, die zur Wahl antreten, sollten in Diskussionen gegeneinander antreten, damit Lesern und Leserinnen deutlich wird, was die vertretenen Positionen und Konzepte unterscheidet und wie schlüssig diese sind. Nur durch eine journalistische Aufarbeitung ist eine Bewertung der politischen Positionen Vorschläge und Konzepte der unterschiedlichen politischen Gruppierungen möglich.
Berichterstattung zur Wahl 2025 in Bochum
Schaut man sich an, wie in Bochum über die Wahl berichtet wird, findet weder eine Wahlberichterstattung statt, die journalistischen Ansprüche genügt, noch sind die stark lückenhaften und selektiven Informationen, die die Bürger und Bürgerinnen über die Lokalmedien erhalten, geeignet, ihnen eine fundierte Wahlentscheidung zu ermöglichen.
Radio Bochum berichtet so gut wie gar nicht, die WAZ beschränkt sich darauf, bei ausgewählten politischen Parteien zu bestimmten Themen deren Position nachzufragen und veröffentlicht diese dann kommentarlos. Immerhin wurden Leser und Leserinnen zunächst in einem Stadtcheck zur Kommunalwahl befragt, in welchen Bereichen sie welchen Handlungsbedarf sehen. Auch die Stadt durfte ausführen, was sie dazu plant.
Wie die Stadt aktuell im Vergleich zu anderen Großstädten dasteht, wie die letzte Wahlperiode zu bewerten ist und wie die Stadt von außen gesehen wird, alles das war und ist dagegen nicht Gegenstand der lokalen Berichterstattung.
Nur bestimmte Parteien dürfen ihre Positionen und Pläne darstellen
Auch gibt die WAZ nur bestimmten politischen Gruppierungen, nämlich jenen mit Fraktionsstatus im alten Stadtrat, die Chance ihre Position zu den Themen, die sich aus dem Stadtcheck ergeben (Wie läuft die Integration in Bochum? Das sagen Politiker, „Kein Bereich zu dunkel“: Das sagt die Politik zur Beleuchtung Stadtbeleuchtung, „Innenstadt sollte grüner sein“: Was die Politik fordert), darzustellen. Das führt zu der skurrilen Situation, dass zur Wahl auch zwei Gruppierungen um eine Stellungnahme gebeten werden, die weder 2020 zur Wahl angetreten sind, noch 2025 zur Wahl antreten (Bündnis Deutschland und FASG)*, dagegen andere im Rat vertretene Gruppierungen (Linke, STADTGESTALTER und Die PARTEI), die 2020 bereits zur Wahl standen und auch 2025 erneut antreten, ihre Konzepte, Ideen und Positionen nicht darstellen dürfen, selbst dann nicht, wenn sie – wie die STADTGESTALTER – zu allen Themen ausführliche Konzepte entwickelt und veröffentlicht haben (Beleuchtung der Bochumer Gehwege sollte systematisch verbessert werden, Alarmierende Zahlen – Höchste Zeit sich ernsthaft um Integration zu bemühen, Grünkonzept Innenstadt – Einige Ideen der STADTGESTALTER übernommen).
Parteien, die zum ersten Mal zur Kommunalwahl antreten, wie Volt oder BSW wird ebenfalls keine Möglichkeit geben, ihre Ansichten zu den entsprechenden Themen darzustellen.
Auf die politischen Gruppierungen, die von der WAZ-Bochum ausgeschlossen werden, wird am Wahltag voraussichtlich rund ein Drittel der Stimmen entfallen. Auch die Überschriften der entsprechenden WAZ-Beiträge, die jeweils die Floskel “die Politik sagt” oder “ die Politik fordert”, enthalten, sind somit irreführend. In den Berichten wird nicht wiedergegeben, was “die Politik” sagt. Es kommen nur zwei Drittel der Bochumer Politik zu Wort.
Warum die WAZ ihren Lesern und Leserinnen zur Kommunalwahl die Positionen einiger politischer Gruppierungen bewusst vorenthält, aber solchen die Gelegenheit gibt sich zu positionieren, die gar nicht zur Wahl antreten, konnte bzw. wollte die WAZ-Redaktion auch auf wiederholte Nachfrage nicht erklären. Zumindest online fehlt auch kein Platz, die Positionen aller politischer Gruppierungen darzustellen, die zur Wahl stadtweit antreten. Im Print wäre eine gekürzte Darstellung mit Link zu den kompletten Ausführungen auf der Internetseite möglich.
Naheliegend ist, man wollte der AfD in der Zeitung zur Wahl kein Forum bieten und hat daher eine verfehlte Regel konstruiert, die die AfD ausschließt, aber u.a. auch Linke und STADTGESTALTER. Diese wurden bei diesem Vorgehen zum Kollateralschaden. Die Redaktion wollte offenbar auf eine Regel verweisen, um keine Diskussionen führen zu müssen, warum sie die AfD von der Berichterstattung ausschließt. Es fehlte der Mut zu einer solchen Entscheidung zu stehen und diese zu rechtfertigen.
Dieses Ansinnen rechtfertigt jedoch nicht, eine sachfremde, unausgewogene und unfaire Regel einzuführen, die auch politischen Gruppierungen die Darstellung ihrer Positionen verweigert, die aktiv die Politik mindestens der letzten elf Jahre mitgeprägt haben und sich nachweisbar mit allen Themen intensiv und konstruktiv beschäftigt haben.
Selektive Berichterstattung vermittelt Lesern und Leserinnen ein falsches Bild von der Wahl
So kommt es zu einer bewussten falschen Darstellung, wer “die Politik“ ist und wer zur Wahl antritt. Zudem wird der Eindruck erweckt, politische Gruppierungen, die nicht in den Beiträgen Stellung nehmen, hätten keine Position zu den Themen bzw. wollten sich zu diesen nicht äußern. Daran ändert sich nichts, dass die WAZ angekündigt hat, kurz vor der Wahl, wenn schon ein Drittel bis die Hälfte der Menschen, die zur Wahl gehen, ihre Stimmen per Brief oder im BVZ abgegeben haben, in einem Beitrag auch über die Positionen und Konzepte der Gruppierungen berichten zu wollen, die sie bis dahin ignoriert hat.
Die beschriebene selektive Berichterstattung ist unausgewogen und verzerrt den politischen Wettbewerb, sie entspricht nicht den publizistischen Grundsätzen (Pressecodex), denen sich deutsche Journalisten verpflichtet haben. Diese sehen eine ausgewogene Wahlberichterstattung vor, die allen politischen Gruppierungen gleichermaßen publizistisches Gehör verschafft und die eine Voraussetzung für eine vielfältige Meinungsbildung ist (siehe auch: Wahlkampf im Lokaljournalismus, Dr. Claudia Riesmeyer, Universität Göttingen). Entsprechend haben die STADTGESTALTER eine Beschwerde an den Presserat gerichtet.
Berichte über Randthemen statt Darstellung politischer Inhalte
Weiterhin beschränkt sich die WAZ bei der Wahlberichterstattung ganz auf die bloße Wiedergabe der Positionen, die die Gruppierungen bei der WAZ eingereicht haben. Eine journalistische Aufarbeitung, kritische Würdigung, Diskussion oder Einordnung findet nicht statt. Die Beiträge hätte statt einer Redakteurin oder eines Redakteurs auch ChatGPT schreiben können, dabei haben Redakteure wie Andreas Rorowski und Carolin Muhlberg vor dem Wahlkampf in der Vergangenheit in etlichen Beiträgen immer wieder gezeigt, dass es an journalistischer Kompetenz bei der WAZ-Bochum nicht fehlt.
Während eine umfassende, vollständige journalistische Darstellung der politischen Inhalte bei der Kommunalwahl-Berichterstattung der WAZ offenbar nicht das Ziel ist, wird ausführlich darüber berichtet, dass diejenigen, die bei der Wahl helfen, 20 Euro Erfrischungsgeld weniger bekommen als bei der Kommunalwahl 2020 (Wahlhelfer in Bochum bekommen weniger Geld – warum?).
Auch über das Anzünden von Wahlplakaten wird umfassend berichtet („Komisches Gefühl“: Plakate von SPD-Kandidatin abgefackelt). Obwohl fünf Plakate angezündet wurden, zwei von der SPD und zwei von den Linken sowie ein weiteres, bei dem nicht erkennbar war, zu welcher Partei es gehörte, erhält nur die SPD im WAZ-Beitrag die Gelegenheit sich als Opfer eines gezielten “Brandanschlags” zu inszenieren, obwohl die Polizei gar keine Anhaltspunkte besitzt, dass das Anzünden der Plakate durch Hass auf bestimmte Parteien oder Kandidaten begründet war.
In einem weiteren Beitrag erhält die SPD als einzige Partei die Gelegenheit ihre Kandidaten für die Bezirksfraktion Wattenscheid samt Bild darzustellen und davon zu berichten, wie gut man doch für die Wahl aufgestellt sei („Sehr schmerzhaft“: Bochumer SPD-Frau von Wahl ausgeschlossen). Anlass ist der Ausschluss einer Kandidatin auf Platz 4 der SPD-Liste für die Bezirksvertretung Wattenscheid, weil diese keinen Hauptwohnsitz in Bochum hat. Ein Ereignis, das an sich eigentlich keinen Nachrichtenwert besitzt und das zum Zeitpunkt des Beitrags auch schon vier Wochen her war. Dafür kann die SPD den WAZ-Bericht bei Weglassen von zwei Absätzen und der Umformulierung von zwei Sätzen problemlos für einen Wahlkampfflyer benutzen.
Während man also bei der WAZ an inhaltlicher und einer allen politischen Kräften gerecht werdenden Berichterstattung spart und auf eine journalistische Aufarbeitung ganz verzichtet, hat man Zeit und Platz für ausführliche Berichte zu Randthemen, die Parteien als Werbeplattform benutzen. Für eine möglichst fundierte Wahlentscheidung der WAZ-Leser und Leserinnen haben diese jedoch keinen Wert.
WAZ-Redaktion gefährdet ihre eigenen Jobs
Eine journalistisch hochwertige Wahlberichterstattung ist aufgrund der knappen personellen Ressourcen in den Lokalredaktionen sicher schwierig. Es sollte aber zumindest möglich sein über alle zur Wahl antretenden Gruppierungen gleichermaßen zu berichten und Berichtsformate zu wählen, die den Lesern und Leserinnen eine Diskussion und differenzierte Würdigung der politischen Positionen ermöglichen. Zum Beispiel sind bei Interviews kritische Nachfragen und Einordnungen durch die Redakteure möglich. Auch Diskussionsformate mit Kandidaten unterschiedlicher Gruppierungen ermöglichen eine Bewertung von Positionen und legen offen, wie valide diese sind.
Für eine bloße Wiedergabe von Statements der politischen Gruppierungen in ansprechend formulierten Beiträgen werden eigentlich keine Redakteure benötigt, das kann mittlerweile auch ChatGPT. Mit dieser Art unjournalistischer Berichterstattung gefährdet die Redaktion ihre eigenen Jobs. Gut möglich, dass in der Essener Zentrale der Funke Mediengruppe schon über eine KI-Software nachgedacht wird, in der bei der Kommunalwahl 2030 alle Parteien und Wählergemeinschaften zu unterschiedlichen Themen ihre Positionen eingeben und die dann auf Knopfdruck zu jedem Thema einen fertigen Beitrag ausspuckt. Die Vorteile, die Software ist billig, schnell und neutral. Auch können problemlos alle politischen Gruppierungen, die zur Wahl antreten, teilnehmen und nicht nur solche, die nach nicht nachvollziehbaren Kriterien ausgewählt wurden. Mit Journalismus hat das Ganze allerdings dann ebenfalls nichts zu tun.
Die Redaktion der WAZ-Bochum sollte sich überlegen, nehmen wir journalistische Berichterstattung ernst, dann sähe ein Konzept zur Wahlberichterstattung völlig anders aus oder bleiben wir bei der bloßen Abfragerei von Positionen, die man dann wiederkäut. Im zweiten Fall wird schon bald ChatGPT diese Arbeit übernehmen.
Unzureichende und unjournalistische Berichterstattung befördert Populismus und Extremismus
Beim WAZ-Stadtcheck bekam die Politik nur die Note 3,9. Schlechter war die Bewertung der Bürger und Bürgerinnen in keiner Kategorie. Das liegt auch daran, dass die lokale Berichterstattung über die kommunale Politik – wie dargestellt – ungenügend und selektiv ist. Hintergründe und Zusammenhänge werden nicht erklärt, die Menschen werden nur unzureichend darüber informiert, welche Ideen und Konzepte die politischen Gruppierungen entwickelt haben. Viele politische Entscheidungen werden kritiklos hingenommen, die Presse gibt regelmäßig ohne jede Einordnung und Nachfrage nur das wieder, was Politik und Verwaltung verlautbaren.
Würden z.B. Probleme wie 200 Mio. Ausgabendefizit im Stadthaushalt 2025/26 adäquat und in angemessener Breite kritisch in der Lokalpresse thematisiert, sähe sich die Politik gegebenenfalls gezwungen die Ursachen mit der notwendigen Dringlichkeit anzugehen. So geht sie davon aus, das Problem würde ohnehin niemanden interessieren, man könne es daher aussitzen. Die Qualität der Politik wird wesentlich durch die mediale Kontrolle bestimmt und durch die Transparenz, die die Presse durch ihre journalistische Arbeit bei politischen Vorgängen schafft. Dieser Aufgabe wird die Lokalpresse in Bochum leider nicht gerecht.
Letztlich ist zu bedenken, dass in Zeiten von Rechtspopulismus und Lügenpresse journalistische Berichterstattung ein wichtiger intervenierender Faktor in der Meinungsbildung ist (Kritischer Journalismus als Korrektiv im gesellschaftlichen Diskurs?). Fällt dieser Faktor wie in Bochum aus und diskreditieren Redaktionen dazu noch ihre Glaubwürdigkeit durch eine selektive Berichterstattung, die eine vielfältige Meinungsbildung verhindert, spielt das den extremen und populistischen politischen Kräften in die Hände und stärkt sie
* Die Fraktion von Bündnis Deutschland ist durch Übertritt aller fünf AfD-Ratsmitglieder zu Bündnis Deutschland entstanden. Die Fraktion FASG („Frieden, Arbeit, soziale Gerechtigkeit“) wurde von drei Ratsmitgliedern der Linken gegründet, die bei den Linken ausgetreten sind.